



Kinder reagieren nicht nur im Straßenverkehr langsamer. Wenn wir ihnen etwas sagen, dann müssen wir einen Augenblick warten, bis das Gesagte angekommen ist und umgesetzt wird. „Du stehst auf der Tasche, geh mal zur Seite“, sagen wir ungeduldig. Doch es ist natürlich, dass das Kind einen Moment braucht, bis es reagiert. Werden wir ungeduldig und schreien es an, dann braucht es noch länger, weil es dann zusätzlich mit unserem Ärger beschäftigt ist. Bei Säuglingen ist die Verzögerung besonders gut zu beobachten: Wenn wir den Säugling ansprechen oder anlachen, dann vergehen einige Augenblicke, bis er uns seine Reaktion zeigt. Die Welt ist oft zu schnelllebig, da sind sich alle einig. Doch die Entschleunigung fängt bei den Kindern an: Wenn wir uns die Zeit nehmen, mit ihnen zu trödeln, wenn wir Abschiedsrituale feiern und Raum für freies Spiel lassen, dann schaffen wir uns und auch anderen eine entspanntere Welt.
Dunja Voos:
Liebst Du mich, auch wenn ich wütend bin?
Was gefühlsstarke Kinder wirklich wollen
Mehr Infos
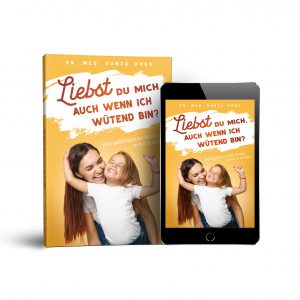
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 25.3.2009.
Aktualisiert am 20.10.2020
Es gibt sicher kaum eine alleinerziehende Mutter, die diesen Satz nicht schon mal gehört hat: „Mein Mann kommt immer erst spät nach Hause – ich bin sozusagen auch alleinerziehend.“ Ich antwortete dann meistens: „Die Tage sind nicht das Problem. Erst in der Nacht spürt man die Last.“ Alleinerziehend zu sein ist deshalb oft so anstrengend, weil abends eben niemand nach Hause kommt. Nach einem anstrengenden Tag fällt man totmüde ins Bett. Und wird vielleicht mitten in der Nacht geweckt, weil das Kind spuckt oder mit Fieber aufwacht. Nachts kommen die Geldsorgen, die Sorgen um die Konflikte mit dem Vater, die Gefühle des Alleinseins und Überfordertseins. Es ist das leere Bett, das schmerzt. Weiterlesen
Wer einen Zusammenhang zwischen zwei Dingen sieht, die in Wirklichkeit nicht zusammenhängen, der denkt magisch. „Klopf auf Holz“, sagen wir, um ein Unglück abzuwenden. Dabei kann Holzklopfen wohl kaum etwas ausrichten. Aber es beruhigt uns. Das magische Denken kann eine Lebenshilfe sein, doch wenn es zu stark wird, wie zum Beispiel bei einer Zwangsstörung, leiden wir darunter. Weiterlesen
Eltern, Lehrer, Ärzte, Führungskräfte kennen es: Die Angst, ihre Autorität zu verlieren. „Das Kind, der Klient, der Mitarbeiter soll mir auf keinen Fall auf der Nase herumtanzen“, sagen sie. Doch was genau befürchten Eltern ebenso wie Führungskräfte, wenn sie um den Verlust ihrer Autorität fürchten? Ein „Autor“ zu sein bedeutet ja, der Urheber von etwas zu sein. Wenn alles gut geht, spüren wir, dass wir etwas bewirken können. Zufriedene Kinder wissen: Wenn ich eine Umarmung brauche und meiner Mutter das zeige, wird sie mir die Umarmung geben. Weiterlesen
Zwei Kleinkinder streiten sich um die rote Schaufel. Die Tränen fließen, das Geschrei ist groß. Um Frieden bemüht sagt die Mutter: „Aber ihr könnt doch zusammenspielen!“ Immer wieder ist die Mutter ratlos, weil sie die Vorstellung hat, dass die Kleinkinder doch teilen und sich abwechseln könnten. Aber damit macht die Mutter sich unnötigen Stress, denn die Kinder sind mit zwei und drei Jahren schlicht noch zu klein. Sie können tatsächlich noch nicht zusammenspielen. Das Argument, (Klein-)Kinder bräuchten andere (Klein-)Kinder, um sich zu sozialisieren, ist weit verbreitet. Dabei kommen die meisten Kleinkinder ganz wunderbar ohne andere Kleinkinder aus. Es ist sogar eher so, dass sich die Kleinkinder gegenseitig stressen, wenn es zu viele sind. Weiterlesen
„Es ist hart“, sagt die Mutter. Und sucht Anerkennung. „Da siehste mal, wie das für mich war!“, sagt deren Mutter. Auch sie sucht Anerkennung. Müde gehen sich beide mit ihren Blicken aus dem Weg. „Ich mach‘ es besser“, denkt die Tochter. Denkt die Mutter. Und die Mutter, die Tochter beendet den Kampf nicht. Anerkennung kann so nicht kommen. Zu alleingelassen waren beide viel zu lange. Lassen ist die Medizin. Weiterlesen