



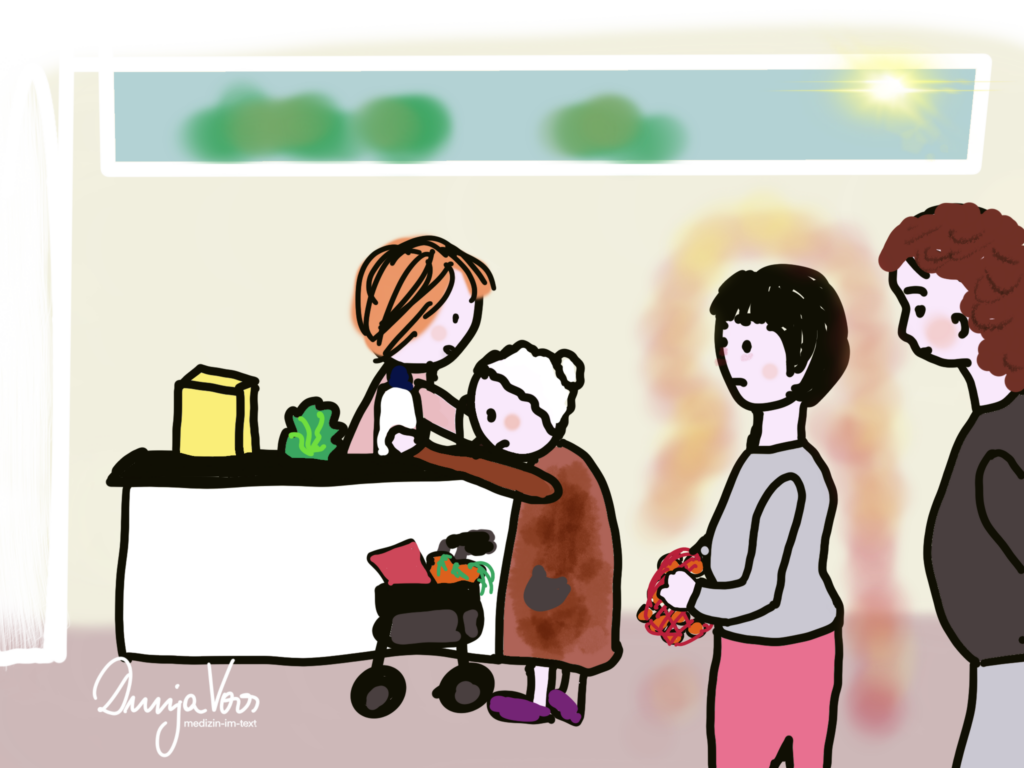
Bei einer Angstattacke fühlst Du Dich möglicherweise ganz schwach. Du zitterst und wenn Dich jemand fragt: „Was hast Du?“, kannst Du eigentlich gar nicht antworten. Es kann sein, dass Dir unglaublich schlecht ist. Du fühlst Dich möglicherweise komisch und alleingelassen. Im Gegensatz zur Furcht, die auf etwas Bestimmtes gerichtet ist und sich konkret anfühlt, ist die Angst vage und schwammig. Es ist Dir vielleicht noch nicht einmal klar, ob es sich um etwas „Inneres“ handelt oder um etwas „Äußeres“. Die Worte „Angst“ und „Enge“ hängen zusammen und während einer Angstattacke möchtest Du vielleicht nur noch weglaufen – raus an die frische Luft.
Manchmal stecken hinter der Angstattacke mehr oder weniger bewusste Erinnerungen an schreckliche Atmosphären und Erlebnisse aus der Kindheit. Es können auch unbewusste Gefühle wie Wut, Neid, Ärger, Hass, Schuld, Eifersucht, sexuelle Erregung oder sogar auch (unerlaubte) Freude dabei sein. Mitunter sind es vermutlich auch angstvolle Gefühlszustände aus der Baby- und Kleinkindzeit, für die es zwrar noch keine Worte gab, an die Du Dich jedoch auf gewisse Weise „erinnern“ kannst. Während Deiner schweren Angstattacke bist Du in einem besonderen körperlichen und psychischen Zustand.
Nicht selten fühlt es sich vielleicht an, als würde die Welt um Dich herum bedrohlich werden. Wenn Du unangenehme Gefühle nicht näher bestimmen oder bestimmten Ereignissen zuordnen kannst, fühlst Du nur eine unbestimmte Bedrohung, die scheinbar ohne Zusammenhang zu irgendetwas steht. Vielleicht fühlst Du Dich wie „ferngesteuert“ oder befürchtest, Dir könnte jemand per Gedankenübertragung etwas Böses tun. Vielleicht hast Du dabei auch ein Gefühl von grenzenloser Verlassenheit. Eine schwere Angstattacke fühlt sich gruselig an. Und manchmal durchleidest Du vielleicht den ganzen Tag oder die ganze Nacht eine Panikattacke nach der anderen und hast das Gefühl, dass das nie wieder aufhört. Doch manchmal können schon eine andere Körperhaltung, der Einfall eines schönen Lichts, eine Regenschauer, eine überraschende Melodie im Radio, ein guter Mensch oder Wärme und Schlaf dazu führen, dass der Angstanfall endet.
Manchmal leidest Du vielleicht auch an anderen unangenehmen Gefühlen, etwa, dass Du Deine eigene Stimme nicht hören magst, dass Dir Deine eigene Hand fremd erscheint oder dass Du Sorge hast, laut loszuschreien. Auch das Gefühl, dass Du neben Dir stehst und Dir fremd bist, kann vorkommen – das nennt man Depersonalisation. Früher zählte man auch solche Symptome oft einfach zur „Panikattacke“, die häufig auch mit einer Hyperventilation einhergeht. Heute spricht man bei diesen Symptomen oft auch von einer „Dissoziation„, weil man davon ausgeht, dass die Symptome mit Erinnerungen und Gefühlen zusammenhängen, die Dir nicht bewusst sind. Was Du bewusst erlebst, scheint in dem Moment zu nichts zu passen, also von dem wahren Grund „dissoziiert“ zu sein.
Wenn Du den Grund Deiner Angst nicht kennst und fast ständig von ihr begleitet wirst, kannst Du daran verzweifeln. Bei dieser frei flottierenden, generalisierten Angst fühlst Du Dich wahrscheinlich sehr ausgeliefert, denn die Angst kommt plötzlich und scheinbar grundlos – Du bist Dir vielleicht sogar nicht sicher, ob die Angst von innen oder von außen kommt. Doch wenn Du eine Psychotherapie oder Psychoanalyse machst, kannst Du mit der Zeit erstaunliche Zusammenhänge feststellen. Du kannst Dich fragen: Was habe ich kurz vorher gedacht oder gefühlt? Was verbinde ich mit der Situation, die mir Angst gemacht hat?
Die frei flottierende Angst ist meistens ein Teil von verschiedenen psychischen Problemen. Beispielsweise ist die Borderline-Störung oder die Psychose oft mit sehr starken Ängsten verbunden. Aber auch Depressionen oder Zwänge können sich mit der Angst abwechseln. Und nicht zuletzt kann auch diese Angst einfach „menschlich“ sein. Der Philosoph Martin Heidegger schreibt über die Angst, die sich nicht näher fassen lässt (etwas kompliziert, aber gefühlt treffend):
„Das Wovor der Angst ist völlig unbestimmt. Diese Unbestimmtheit lässt nicht nur faktisch unentschieden, welches innerweltliche Seiende droht, sondern besagt, dass überhaupt das innerweltliche Seiende nicht ‚relevant‘ ist. Nichts von dem, was innerhalb der Welt zuhanden und vorhanden ist, fungiert als das, wovor die Angst sich ängstet. … Die Welt hat den Charakter völliger Unbedeutsamkeit. In der Angst begegnet nicht dieses oder jenes, mit dem es als Bedrohlichem eine Bewandtnis haben könnte. …
Dass das Bedrohende nirgends ist, charakterisiert das Wovor der Angst. Diese ‚weiß nicht‘, was es ist, davor sie sich ängstet. …
Das Drohende kann sich deshalb auch nicht aus einer bestimmten Richtung her innerhalb der Nähe nähern, es ist schon ‚da‘ – und doch nirgends, es ist so nah, dass es beengt und den Atem verschlägt – und doch nirgends. … das Wovor der Angst ist die Welt als solche. …
Was beengt, ist nicht dieses oder jenes, aber auch nicht alles Vorhandene zusammen als Summe, sondern die Möglichkeit von Zuhandenem überhaupt, das heißt die Welt selbst. Wenn die Angst sich gelegt hat, dann pflegt die alltägliche Rede zu sagen: ‚es war eigentlich nichts‘. … wovor die Angst sich ängstet, ist das In-der-Welt-sein selbst.“ (Martin Heidegger: Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag Tübingen, 2006: S. 186/187)
Während einer Angstattacke versucht Du vielleicht, Dich durch Selbstgespräche zu beruhigen, doch möglicherweise gehst Du verärgert und hart mit Dir ins Gericht. Vielleicht sagst Du Dir: „Reiß‘ Dich zusammen!“, oder: „Es besteht doch gar kein Grund, jetzt Angst zu haben!“ Doch im Moment der Angst scheint das nicht zu helfen. Wenn es Dir auffällt, dass Du harte Selbstgespräche mit Dir führst, versuche, weicher zu werden. Denke an ein Vorbild oder an jemanden, der Dich mag und gut behandelt.
Manchmal musst Du die Angstattacke abwarten wie eine Regenschauer. Manchmal hilft der Rückzug in einen eigenen Raum, ein heißer Tee, eine Decke, eine Wärmflasche, eine Katze auf dem Schoß oder eine heiße Dusche. Wenn Du eine Psychotherapie machst und eine gute Beziehung zu Deiner Therapeutin/Deinem Therapeuten hast, versuchst Du vielleicht auch, Dir Deinen Therapeuten vorzustellen. Und das kann helfen.
Der Therapeut kann in der Vorstellung manchmal die Angst beruhigen. Psychoanalytisch gesprochen ist der Therapeut dann ein neues, beruhigendes inneres Objekt. Auch ein neuer Partner, ein neuer Lehrer oder neue, emotional bebildete Nachbarn können zu einem beruhigenden „inneren Objekt“ werden, wenn Du an sie denkst.
Menschen mit einer Phobie haben sehr starke Angst vor bestimmten Dingen: vor Spinnen, engen Räumen, weiten Plätzen oder großen Höhen. Davon kann man sich meistens fernhalten. Schlimm ist es, wenn man nicht vor dem weglaufen kann, wovor man sich fürchtet: Bei einer Emetophobie (Angst vor dem Erbrechen), einer Hypnophobie (Angst vor dem Einschlafen und Schlafen) oder einer Thanatophobie (übersteigerte Angst vor dem Tod) gibt es kein Entrinnen. Diese Gefühle erscheinen oft unaushaltbar. Andere leiden an einer Sozialen Phobie und trauen sich kaum noch aus dem Haus. Die Fahrt mit der Straßenbahn wird ebenso unmöglich wie das Reden vor einer Gruppe.
Hinter den sehr großen Ängsten steckt oft die grundlegende Angst, bei anderen Menschen nicht gut aufgehoben zu sein. Wer sehr verunsicherte, wenig herzensgebildete, hilflose oder gewalttätige Eltern hatte, hat später generell oft ein angsterfülltes Bild von anderen Menschen.
Wenn Dich Deine Eltern übermäßig oft beschämten, leidest Du vielleicht auch unter der Vorstellung, überwiegend mit beschämenden, überkritischen Augen angeschaut zu werden. Vielleicht hast Du auch Angst davor, Dich unter Menschen zu begeben (z.B. beim Einkaufen), weil sie Dir haltlos erscheinen. Betrunkene oder „asoziale“ Menschen erinnern Dich vielleicht an die Schwäche und Haltlosigkeit in Deiner Vergangenheit.
Auch wenn es sich für Dich vielleicht nicht so anfühlt: Ein Leben, das weitaus angstfreier ist, ist möglich. Meistens empfehlen Hausärzte bei der Angststörung erst einmal Medikamente oder eine Verhaltenstherapie. Für manche ist dies ein guter Weg, um überhaupt erst einmal wieder „lebensfähig“ zu werden. Andere bleiben lieber ohne Medikamente, weil sie das Gefühl haben, dann einen besseren inneren Kompass zu haben. Ich sehe das meistens auch so.
Hat die Angst ihren Ursprung in einer frühen Störung bzw. in frühen Traumata, so hat die psychoanalytische Therapie mit drei oder vier Terminen pro Woche oft noch andere Möglichkeiten als die Verhaltenstherapie, weil sie das Unbewusste ausgiebiger anspricht. Durch die häufige Stundenzahl und die Art der Sitzungen ergeben sich natürlicherweise oft starke Emotionen und Gedanken, sodass man an ihnen arbeiten kann, während sie aktuell und aktiv sind. Es können oft bis zu 300 Sitzungen von der Krankenkasse genehmigt werden. Du lernst, Dich selbst besser zu verstehen, was einen sehr beruhigenden Effekt haben kann.
Wenn Du noch Angst hast vor einer Therapie, kannst Du Dir zunächst selbst etwas helfen, z.B. indem Du Dich mit Deinem Atem auseinandersetzt (was auch Angst machen kann) oder indem Du täglich bewusst darauf achtest, möglichst bei der Wahrheit zu bleiben – vor Dir selbst und vor anderen. Auch Deinen Körper in Form zu bringen, Dich gesund zu ernähren, Dich zu bewegen und ausreichend zu schlafen, kann deutlich angstmindernde Effekte haben – aber Du brauchst Geduld, Ausdauer und oft auch Disziplin. Leichter wird alles in einer Therapie, da diese mit einer Beziehung verbunden ist und Du nicht alleine bist.
Was in der Psychotherapie oder Psychoanalyse gut tut, ist die Beziehung zum Therapeuten, wenn er abgegrenzt und gleichzeitig interessiert ist. Insbesondere seine gleichschwebende Aufmerksamkeit und seine Präsenz sind wirksam. Oft ist es gar nicht so wichtig, was er sagt, sondern allein das Gefühl, dass er emotional wirklich dabei ist, kann schon zu einem Gefühl zunehmender Sicherheit und Festigkeit fühlen. Das zunehmende Gefühl von Schutz und Sicherheit kann sich langsam auch auf andere Lebensbereiche ausdehnen. Irgendwann wird das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit zu einem normaleren Zustand.
Eine psychoanalytische Therapie dauert jedoch lange, weil sich Gefühle, Vorstellungen, unbewusste Phantasien, sogenannte „Glaubenssätze“, und Erlebensweisen nur sehr langsam verändern. Dazu braucht es neue Erfahrungen. Manche Menschen leiden zum Beispiel an einer Angststörung, weil sie nur sehr selten die Erfahrung gemacht haben, wie es ist, eine gesunde Beziehung zu einem anderen Menschen zu haben. Dadurch erscheinen andere Menschen rasch als bedrohlich.
Ein Kind macht normalerweise viele hundert Male die Erfahrung, wie es ist, von der Mutter beruhigt zu werden. Mit der Zeit verinnerlicht das Kind dieses Zusammenspiel, so dass es sich schließlich selbst beruhigen kann. Wer aber besonders gestresste oder traumatisierte Eltern hatte und vielleicht auch aus einer schwachen sozialen Schicht kommt, konnte dies eventuell nur zu selten erleben. Daraus entsteht häufig ein wackeliges Lebensgefühl, das nur langsam zu einem sicheren Gefühl werden kann. Dazu sind viele beruhigende Erfahrungen innerhalb einer Beziehung notwendig.
Wenn Du eine Angststörung hast, hast Du vielleicht schon bemerkt, dass Du im Moment der Panik vielleicht nicht weinen kannst, obwohl Du gerne weinen würdest. Es würde Dich erleichtern. Und wenn Du eine Depression hast, dann fällt es Dir vielleicht auch schwer, zu trauern. Die Trauer ist ein reifes Gefühl. Du kannst nur trauern, wenn Du Dich selbst als eigenständigen Menschen erlebst und etwas verlierst, was Dir viel bedeutet hat. Du musst es als wirklich verloren erleben. Dann kommen oft Tränen der Trauer, die aber auf gewisse Art auch erleichtern können. Vielleicht fällt es Dir leichter, im Beisein eines anderen zu weinen, als alleine -vielleicht ist es aber auch umgekehrt. In einer Psychotherapie ist es oft leichter, Trauer zuzulassen, als wenn man alleine ist.
Eine Psychoanalyse ist oft mit vielen schmerzhaften Einsichten und Trauer verbunden: Vielleicht war die Kindheit doch nicht so schön wie man dachte, vielleicht hätte ein anderer Beruf besser gepasst, vielleicht macht man sich in seiner Partnerschaft schon lange etwas vor. Außerdem ist man selbst viel „böser“, als man je gedacht hätte. Es entsteht vielleicht das Gefühl, Entscheidendes verpasst zu haben. Eine Veränderung würde doch jetzt nichts mehr bringen, könnte der Gedanke lauten.
Doch durch Einsichten in jedem Alter ergeben sich neue „Steuerungsmöglichkeiten“, sodass alte Automatismen aufhören können und die Kreativität erwacht.
Der Therapeut ist da und kann begleiten, konfrontieren, klären, trösten und verstehen. Man selbst kann den Therapeuten lieben und hassen. So lassen sich Wahrheiten annehmen, die man vorher nicht sehen konnte oder wollte. Es kommen vielleicht Trauer, Wut und Enttäuschung auf. Aber die Angst geht durch diese neuen emotionalen Erkenntnisse häufig zurück. Durch die Therapie erweitert sich die Gefühlspalette, sodass die krankhafte Angst relativ gesehen nur noch einen kleineren Teil davon einnimmt. Die tiefe, schreckliche Angst kann zwar immer wieder auftauchen – oft wird sie durch eine psychoanalytische Therapie jedoch seltener und sie lässt sich häufig besser einordnen. Du fühlst Dich dann mitunter nicht mehr ganz so verloren. Nach der Psychoanalyse hast Du vielleicht auf paradoxe Weise eine andere Angst als vor der Analyse, obwohl es dennoch dieselbe geblieben ist.
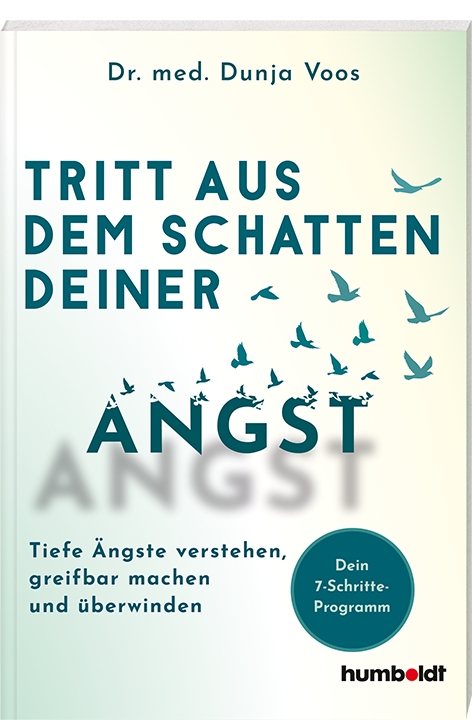
Dunja Voos (2022):
Tritt aus dem Schatten Deiner Angst
Dein Sieben-Schritte-Programm
Humboldt-Verlag
amazon
Dunja Voos:
Schwere Angststörungen – was kann ich tun?
https://youtu.be/iA07LA0r4Y8
Ines Kunz:
Anststörungen: Häufigkeit, Symptomschwere, biographische und aktuelle Risikofaktoren sowie Persönlichkeitsprofile unter besonderer Berücksichtigung von hysterischen und Borderline-Strukturen. Dissertation, Universität Mannheim 2006
http://archiv.ub.uni-heidelberg.de/volltextserver/volltexte/2006/6308/index.html
Kate Walters et al. (University College, London, 2008):
Panic disorder and risk of new onset coronary heart disease,
acute myocardial infarction, and cardiac mortality.
European Heart Journal, October 2008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18948354
Jordan Smoller et al. (2007):
Panic Attacks and Risk of Incident Cardiovascular Events
Among Postmenopausal Women.
Archives of General Psychiatry 2007
http://archpsyc.ama-assn.org/cgi/content/abstract/64/10/1153
I Kawachi et al. (Harvard School of Public Health, Boston, USA, 1994):
Symptoms of anxiety and risk of coronary heart disease.
The Normative Aging Study.
Circulation. 1994; 90: 2225-2229
doi: 10.1161/01.CIR.90.5.2225
http://circ.ahajournals.org/content/90/5/2225.short
Ripke, Annekatrin Asja (2007):
Experimentelle Studie zur Thrombozytenaktivierung
durch psychisch induzierten Stress
bei Patienten mit vermehrten Ängsten.
Dissertation, Universität zu Lübeck, 2007
http://www.zhb.uni-luebeck.de/epubs/ediss337.pdf
Mariana Leky: Erste Hilfe. Roman, Dumont, S. 122-124: „… ‚Man kann vor allem Angst haben … man kann zum Beispiel Angst haben, sich zu waschen. Oder sich nicht zu waschen. Oder davor, ans Telefon zu gehen. Oder vor zu niedrigen Tischen oder davor, vor anderen Leuten zu essen, oder vor großen oder kleinen Räumen. … Man kann vor Hochhäusern Angst haben oder vor Tiefgaragen oder vor dem eigenen Herz … oder vor Tieren mit Haaren oder nackten Tieren, oder davor, Briefe zu öffnen … Man kann Angst vor Blumen oder vor Bärten haben … Man kann auch Angst vor dem eigenen Bauchnabel haben. Man kann sogar Angst vor den eigenen Haaren haben … dann kann man sich nicht mehr kämmen. … Und alle haben erst eine bestimmte Angst und können irgendwann gar nichts mehr‘, sagt die Therapeutin.“
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht 2007
Aktualisiert am 24.3.2024
VG-Wort-Zählpixel im ersten Abschnitt, 4213368a3be548b1a44b2754ce7cc5b3
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Das freut mich, lieber Herr Unkauf :-) Vielen Dank.
Sehr guter Artikel der auch aufzeigt das es Auswege gibt. Die anderen Artikel lassen einen häufig zurück mit einem Gefühl der Hilflosigkeit
Vielen Dank für diesen aufschlußreichen Artikel: im Rahmen einer integrativen, oder wie Klaus Grawe, auf den sich mein Vorredner bezieht, „allgemeinen“ Psychotherapie ist es sicher wichtig, neben den aktuellen Auslösesituationen auch die kindlichen Früherfahrungen mit in den Blick zu nehmen. Dennoch denke ich, dass Verhaltenstherapie und hier insbesondere die Expositionsverfahren die Psychotherapie der Wahl bei Angsterkrankungen sind. Es ist auch nicht so, dass es zu einer Symptomverschiebung kommt, sondern die Effekte ziemlich stabil sind. Aber ich gebe Recht: es ist wichtig, nicht nur das aktuelle Verhalten, sondern die gesamte Person mit ihrer individuellen Biographie im Blick zu haben!
Sehr geehrter Gast,
vielen Dank für Ihren Hinweis.
Eine Studie, die zeigt, dass psychodynamische Therapien bei generalisierter Angststörung so wirksam sind wie die kognitive Verhaltenstherapie (CBT) wurde von Falk Leichsenring und Kollegen 2009 veröffentlicht:
Short-Term Psychodynamic Psychotherapy and Cognitive-Behavioral Therapy in Generalized Anxiety Disorder: A Randomized, Controlled Trial
Am J Psychiatry 2009;166:875-881. doi: 10.1176/appi.ajp.2009.09030441
The American Journal of Psychiatry, VOL. 166, No. 8
http://www.dsm.psychiatryonline.org/article.aspx?articleID=101023&atab=7
Die Studien, die ich auf der Unterseite „Psychoanalyse wirkt“ gelistet habe, zeigen allgemein die Wirksamkeit von psychoanalytischen Therapien bei verschiedenen Störungen, u.a. bei Angststörungen (https://www.medizin-im-text.de/2011/28/psychoanalyse-wirkt).
Die Kritik von Klaus Grawe an der Psychoanalyse ist sehr umstritten – mehr Informationen hierzu finden Sie in meinem Blog hier: https://www.medizin-im-text.de/2010/6130/klaus-grawe-und-der-ruf-der-psychoanalyse.
Dunja Voos
Es würde mich interessieren, auf welchen Daten die Aussage fusst, bestimmte psychoanalytische Methoden seien für die Behandlung von Angststörungen „Mindestens genauso geeiget“ wie die Verhaltenstherapie. Die Metaanalyse von Grawe et al. [1] beispielsweise zeichnet hier ein anderes Bild…
[1] Klaus Grawe, Ruth Donati, Friederike Bernauer: Psychotherapie im Wandel. Von der Konfession zur Profession. Hogrefe, Göttingen 1994.
Meiner Erfahrung nach gibt es außer den oben beschriebenen psychotherapeutischen Methoden, durchaus noch weitere, die für Angstörungen eingesetzt werden können. Das sind vor allem die energetische Psychotherapie, die mit Klopfakupressur arbeitet, die Kinesiolgie, die auch die durch die Angstörung entstandenen Blockaden im Energiesystem löst und nicht zuletzt auch die Hypnose. Auf welche Methoden ein Patient am besten reagiert, ist sehr individuell. Und so kann ich mich dem Artikel nur anschließen: ein angstfreieres Leben ist wirklich möglich.
Danke für die grundlegenden Infos, wir suchen zurzeit noch Betroffene, die unter http://angst-stoerung.net/ ihren Erfahrungsbericht veröffentlichen möchten.
Liebe Grüße