



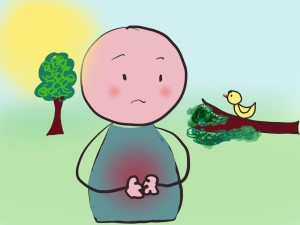
Während wir unter wechselnden Körperbeschwerden leiden und uns immer wieder quälende Sorgen darum machen, fühlen wir uns alleingelassen. Andere nehmen uns oft nicht mehr ernst. Doch häufig gibt es einen sehr ernsten Hintergrund: Viele, die unter der Angst vor Krankheiten (Hypochondrie) leiden, haben als Baby und Kind schon viele medizinische Behandlungen und mitunter auch Gewalt über sich ergehen lassen müssen. Frühe Trennungen von der Mutter, die erste Lebenszeit im „Brutkasten“, Operationen und Therapien wie die Vojta-Therapie waren frühe Angriffe auf den Körper. Diese frühen Erfahrungen sind ein Leben lang als quälende und beängstigende Körpererinnerungen da.
Zudem ist unser Körper auf eine Art unsere nächste Bezugsperson. Er ist „sprachlos“, wenn man unter Sprache nur „Worte“ versteht. Er spricht jedoch zu uns, indem er uns zeigt, wie es ihm geht. Über die Hypochondrie spreche ich auch mit Zen-Meister Muho-Nölke im Youtube-Video Nr. 8: „Du willst mich nicht verstehen!“ (ab Min. 53)
Wir haben eine enge Beziehung zu unserem Körper. Er zeigt, was mit ihm los ist, aber wir können nicht direkt mit ihm sprechen. Auch wir selbst konnten als Babys noch nicht sprechen. Wir konnten nur durch Schreien und Körperzeichen zeigen, wie es uns geht. Wir waren darauf angewiesen, dass unsere Mutter und unsere nächsten Bezugspersonen uns verstanden und gut behandelten. Konnten wir unseren nächsten Bezugspersonen nicht trauen, so misstrauen wir möglicherweise auch dem eigenen Körper. Andererseits dürfen wir bei aller Theorie nicht vergessen, dass unser Körper wirklich leidet. Die vielen Beschwerden bilden wir uns nicht ein – unser Körper sendet uns Signale, die auf frühe Verletzungen hinweisen.
Die Bindung zu unserem Körper kann desorganisiert oder ambivalent-unsicher sein, ähnlich wie es die Bindung zu unseren frühen Bezugspersonen möglicherweise war (siehe Bindungstheorie und Bindungsstile).
Je älter wir werden, desto schlimmer kann unsere Angst werden, ins Krankenhaus zu müssen und wieder hilflos medizinischen Behandlungen ausgesetzt zu sein. Andererseits führen die Behandlungen immerhin dazu, dass sich jemand um uns kümmert. Ein höheres Lebensalter erhöht die Gefahr, tatsächlich körperliche Krankheiten zu entwickeln. Die Hypochondrie ist auch ein Leiden, das uns mit unseren frühesten Kindheitsgefühlen verbindet und uns mit den Themen Ohnmacht, Einsamkeit, Trennung und Tod konfrontiert.
Wenn wir hypochondrisch sind, dann geht es uns wie nachts um halb drei: Kleinste Körpersignale wecken die nichtsprachlichen Erinnerungen und die Phantasie und lassen das Schlimme, das wir erlebt haben, wieder wach werden. Wir fürchten uns vor Krebs, also an etwas „Bösem“ und vor dem Schlaganfall, also vor der Lähmung und Ohnmacht, die wir vielleicht einst erlebten.
Manche Therapeuten vermuten, dass auch die Regulation der eigenen „bösen Affekte“, also der Aggressionen nicht gut gelingt und dadurch der Körper zum Spiegelbild unserer Gefühle wird. Meiner Erfahrung nach kann dies tatsächlich manchmal so sein – jedoch greift diese Erfahrung bei vielen Menschen, die als Kleinkind körperlich traktiert wurden, zu kurz. Wie es bei einem selbst ist, kann man am besten in einer Psychoanalyse und durch ehrliche Wahrheitssuche erfahren.
Wenn wir im Schlaf unseren Körper spüren, dann haben wir starke Phantasien und Traumgedanken. Zum Beispiel können wir von einer Überflutung träumen. Wenn wir aufwachen, bemerken wir, dass unsere Blase voll ist. Wir haben unsere volle Blase wahrgenommen, doch weil wir schliefen, galten die Wahrnehmungsgesetze des Schlafes und des Traums – wir träumten von der Katastrophe der Überflutung.
Vielleicht sind wir hypochondrisch und dabei tatsächlich in einer körperlich schlechten Verfassung. Vielleicht leiden wir an einem geschwächten Gleichgewichtssystem, sodass wir rasch Schwindel empfinden. Dieser hängst dann oft mit der Angst zusammen, ohnmächtig zu werden. Wenn wir unser Gleichgewichtssystem durch Muskel- und Gleichgewichtstraining stärken, fühlen wir uns kräftiger. Schwindel und die Ängste tauchen seltener auf. Unter Umständen kann sich so auch eine Agoraphobie (Angst vor freien Plätzen) verbessern.
Bei der Hypochondrie ist die Kommunikation zwischen dem „sprechenden Ich“ und dem averbalen, sich erinnernden Körper erschwert. Es gibt eine ähnliche Grenze wie zwischen dem Bewussten und dem Unbewussten: So sehr wir uns bei starken Ängsten gut zureden, so wenig können wir uns im Innersten damit erreichen. Es ist, als machte der Körper, was er wollte. Doch wir können unseren Körper „erziehen“ wie einen schwer traumatisierten Hund, indem wir eine vorsichtige und behutsame Beziehung zu ihm aufnehmen.
Durch viele kleine Schritte können wir uns unserem Körper annähern. Vielleicht erschrecken wir schon, wenn wir nur das Wort „Körper“ hören. Manches ist vielleicht schwer – wie z.B. Tanzen, Körperpflege, In-den-Spiegel-Schauen, Rausgehen, Schulsport usw. Doch wenn wir dranbleiben und vieles ausprobieren, kann es uns mit der Zeit besser gehen. Wir können mit dem Laufen beginnen oder mit dem Schwimmen oder mit Youtube-Videos von Merete Holm Brantbjerg. Das Wichtigste ist jedoch vielleicht, die gedankliche Verbindung herzustellen zwischen unseren jetzigen Körperempfindungen und Ängsten und den frühen Körpererfahrungen, die wir gemacht haben. So können wir selbst uns viel ernster nehmen – und das hilft uns in der Kommunikation mit anderen.
Schließlich kann traditionelles Yoga bei Hypochondrie hilfreich sein. Durch regelmäßige Atemübungen (Pranayama) können wir unseren Körper in eine bessere Verfassung bringen. Wir fühlen uns generell gestärkt und lernen uns besser kennen.
Welches Verhältnis wir zu Mutter und Vater in unserer frühesten Kindheit hatten, spiegelt sich auch im Verhältnis zu unserem Körper wider. Beispielsweise haben Mütter von Schreibabys das Gefühl, sie könnten ihr Baby gar nicht verstehen und auch nicht beruhigen. Ähnlich fühlen wir uns, wenn unser Körper beginnt, mit Symptomen zu „schreien“: Wir können ihn scheinbar kaum verstehen, kaum richtig interpretieren und auch nur schwer beruhigen. Zu schwer war das Trauma, das wir durchmachten. Unser Körper erzählt uns eine Geschichte – so wie das Schreibaby sein Leid zum Ausdruck bringt und uns mitfühlen lässt, wie schrecklich es sich fühlt.
Psychotherapeuten, die mit Müttern und Säuglingen arbeiten, finden manchmal eine Herangehensweise an das „Schreibaby“. „Das Baby schrie so laut, dass man sein eigenes Wort nicht mehr hören konnte“, sagt eine Psychoanalytikerin. Dennoch gelang es ihr, zum Baby zu sprechen. Sie erklärte dem Baby, warum es so schreit und tatsächlich konnte es sich beruhigen.

Unser schulmedizinisches System kann Hypochondrien verstärken, da wir in unserem System meistens nur auf einzelne Organe schauen. Der Arzt findet eben nichts, doch wir spüren noch den Tsunami zu Beginn unseres Lebens. Andererseits kann die Schulmedizin uns auch beruhigen: Das unauffällige EKG, MRT- oder Röntgenbild können uns für eine Weile genauso die Angst nehmen wie der Laborzettel mit unauffälligen Laborwerten.
Aus meiner Sicht hilft es am besten, sich seinem Körper langsam und vorsichtig neu anzunähern und sich gut mit seinem Körper zu beschäftigen. Was tut uns gut? Eine Wärmflasche, das Liegen auf dem Boden, eine warme Dusche oder die frische kühle Morgenluft? Manche fühlen sich relativ befreit von ihren vielen Beschwerden, wenn sie sich ruhig verhalten, still liegen oder endlich in den Schlaf finden. Anderen geht es besser, wenn sie sich bewegen. Das Stillwerden zu erlernen, kann sehr hilfreich sein – es geht anfangs oft besser, wenn nebenan andere Menschen herumwuseln. Routinen können dabei unterstützen. Wer täglich früh am Morgen eine halbe Stunde Yoga macht, kann meditativ durch seinen Körper gehen und alles durchchecken. Auch der Gang zum Bäcker, eine Runde Laufen oder ein paar Bahnen Schwimmen können enorm stärken, wenn man es jeden Tag macht.
So, wie die Mutter eines Schreibabys in einer Therapie ihr Baby kennenlernen kann, so kann bei der Hypochondrie eine Psychotherapie dabei helfen, sich selbst und seinen Körper besser kennenzulernen.
Körperliche Symptome können mithilfe einer Psychotherapie leichter eingeordnet werden. So können wir unsere Beschwerden selbst besser „containen“. Vielleicht beunruhigen sie uns nicht mehr so sehr oder aber sie lassen tatsächlich nach. Ruhige Tage wie z.B. Sonn- und Feiertage sind für Hypochonder oft schwer erträglich, weil Ruhe und Einsamkeit zu quälenden Gefühlen führen können, die sich auch im Körper und in den Gedanken zeigen.
Der Gang in die Notaufnahme erleichtert so manchen Hypochonder – nicht nur, weil er an Bildern und Messwerten sieht, dass „alles in Ordnung“ ist, sondern auch, weil der Kontakt zum Pflegepersonal und zu den Ärzten zumindest kurzzeitig aus dem quälenden Alleinsein mit sich selbst führt.
Manchmal ist das, was uns wirklich fehlt, ein emotionaler Kontakt. Wenn Liebe dauerhaft fehlt, produziert der Körper möglicherweise psychosomatische Symptome (Komisaruk and Whipple, 1998). Manchmal hilft der kurze Rückzug in die Ruhe, ein anderes Mal erleichtert uns ein sinnvolles Gespräch. Auch Wärme ist oftmals erleichternd – sich eine Wärmflasche auf den Bauch zu legen, kann sehr beruhigend sein. Meine Erfahrung ist auch, dass bestimmte Körperhaltungen im Yoga die Beschwerden lindern können oder aber sie lindern zumindest die schwere Sorge um die Beschwerden.
Letzten Endes geht es bei der Angst um den Körper um die Angst vor dem Sterben. Nicht wenige Hypochonder waren dem Tod schon sehr nahe. Da ist die Angst, alleine oder zu früh sterben zu müssen, andererseits die Sehnsucht nach (Todes-)Ruhe.
Gleichzeitig besteht die Angst, in die Fänge unseres Gesundheitssystems zu geraten – an Ärzte, die keine Geduld haben und nicht verstehen, an Ärzte, die etwas übersehen.
Man möchte nicht in einem Krankenhaus „ans Bett gefesselt“ sein oder der Apparatemedizin ausgeliefert werden. Hier spiegelt sich der Kampf um die Dankbarkeit um unser Gesundheitssystem und das Verfluchen dieses Systems wider. Was soll man tun, wie soll man sich entscheiden, während man an körperlichen Beschwerden leidet?
Manchen Menschen hilft es, sich mit den Themen „Schuld“ und „Selbstbestrafung“ auseinanderzusetzen. Manchmal sind körperliche Symptome wie eine Selbstbestrafung – solange sie da sind, muss man keine Schuld spüren. Als „Opfer“ oder als „kranker Mensch“ ist man der/die Arme. Vielleicht kommt sogar ein sekundärer Krankheitsgewinn hinzu.Solche Erklärungen werden in einer Psychotherapie häufig hinzugezogen, jedoch erscheinen sie mir nicht immer hilfreich. Eher glaube ich, dass sich sehr frühe Körper- und Beziehungserfahrungen in den Körperbeschwerden und den hypochondrischen Ängsten zeigen.
Mitgefühl mit sich selbst hilft, doch es ist nicht immer leicht, es aufzubringen, weil man selbst schon „genervt“ ist vom eigenen Körper. Eine gute Selbstbeobachtung und ein Gespür für die eigene Not können jedoch erwachsen. Auch hilft es, die Wut und die Trauer, die mit dem eigenen Zustand verbunden sind, wahrzunehmen. Wenn man es schafft, etwas abzuwarten, ohne aktiv zu werden, kann man auch die Erfahrung machen, wie die Beschwerden wieder vergehen und die Angst nachlässt.
Elisabeth Waller (2006):
Somatoforme Störungen und Bindungstheorie
Verlag Dr. Kovac
https://www.verlagdrkovac.de/978-3-8300-2195-7.htm
Komisaruk & Whipple, 1998: „… this definition of love encompasses having an emotional bond with a person for whom one yearns, as well as having sensory stimulation that one desires. … We propose a neural mechanism by which deprivation of love may generate endogenous, compensatory sensory stimulation that manifests itself as psychosomatic illness.“
(Übersetzt von Voos:) „Wir stellen einen Mechanismus vor, der zeigt, wie das Fehlen von Liebe eine kompensatorische, sensorische Stimulierung auslösen könnte, die sich dann als psychosomatische Erkrankung manifestiert.“
Barry R. Komisaruk and Beverly Whipple (1998):
Love as sensory stimulation: Physiological consequences of its deprivation and expression.
Psychoneuroendocrinology, Volume 23, Issue 8, November 1998, Pages 927-944
https://doi.org/10.1016/S0306-4530(98)00062-6 https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0306453098000626
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht im Oktober 2012.
Aktualisiert am 22.6.2024
VG-Wort Zählpixel im ersten Abschnitt (5b97b0e25b014ed0aae79798016af828)
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
es tut so gut zu lesen, dass ich nicht allein bin, aber irgendwie macht es mich verdammt traurig, dass es so viele Menschen gibt, die eben an dem selben problem leiden, ich bin 19, ich hatte bis vor kurzem gar nicht daran gedacht, dass es hypochondrie sein könnte, ich suche jetzt schon seit ca einem jahr bei so vielen ärzten nach hilfe, ich hab weder freunde noch eine arbeit wegen meinem problem, ich isoliere mich sogar von meiner familie und das macht mich langsam so kaputt, aber mir ist immer schlecht, dauerhaft. ich kann eben bei übelkeit bei niemanden sein, aus angst, dass ich mich evtl übergeben müsste und diese übelkeit kommt definitiv vom gehirn, sei es ein tumor, oder eine durchblutungsstörung, schwindel kommt auch hin und wieder dazu…, es macht wirklich keinen spaß, sein leben so zu verbringen, ich will mein altes leben wieder, in dem ich wenigstens mal raus konnte und freunde treffen konnte, aber das alles vermeide ich, wodurch ich schon den ein oder anderen freund verloren habe. wenn ich meiner familie davon erzähle, dann fühlt es sich an, als würde es ihnen egal sein, weil ich gefühlt nur noch davon rede, ich fühle mich wie ein schrecklicher mensch und ich will nicht, dass mein leben an mir vorbei läuft, ich sollte jetzt eigentlich arbeiten und geld verdienen und mein leben leben, aber nein, ich sitze hier, tag ein, tag aus, in der hoffnung, dass ich etwas essen kann, ohne dass mir schlecht wird, ich würde auch verdammt gerne wieder die sachen essen, die ich essen will, ich verzichte auf alles was spaß macht, einfach nur wegen dieser angst, ich würde mein Verhalten so gerne ändern, aber ich kann nirgends hin, weil ich auf das auto angewiesen bin und naja, bei übelkeit Autofahren… ich will einfach wieder ein normales leben, aber es fühlt sich so an, als würde es nie enden, sondern immer schlimmer werden… in einem monat habe ich endlich meinen Termin beim Neurologen, wenn der auch nichts findet, dann bin ich mir sicher, dass es hypochondrie ist, was mich einerseits froh macht, weil es dann kein körperliches problem wäre, aber andererseits würde es mich enttäuschen, weil das Problem dann nicht „sofort“ behoben werden könnte
Auch ich (34 Jahre) leide an diesen Ängsten.
Ich habe fürchterlich grausame Angst im Magen-Darm-Bereich zu erkranken oder sogar schon krank zu sein. Ich habe viel Durchfall, seit mir 2010 die Gallenblase entfernt wurde.. An „normalen“ Tagen muss ich 2-3 Mal zur Toilette; an meiner Meinung nach schlechten Tagen auch mal viermal. Da ich bei Dr. Google mal gelesen habe, das mehr als dreimal nicht normal ist, mach ich mir dauernd Gedanken darum. Ich kann ohne Angst nicht mehr zur Toillette gehen. Dabei kontrolliere ich ALLES ganz genau z.B. auf Blut usw.
Es ist bei mir ein teuflischer Kreislauf: Stressige Situationen (so auch die Ängste) schlagen mir sofort auf den Darm = Durchfall! Wegen dem Durchfall bekomme ich dann panische Angst und das führt zu mehr Durchfall was wiederum mehr Angst verursacht. Da komme ich einfach nicht raus.
Eine Woche vor Pfingsten 2014 war ich beim Zumba. Ich hatte wieder Durchfall und musste danach wirklich dringend zum Klo. Die Toiletten im Fitnesstudio ähneln einem öffentlichen Klo. Türen oben und unten offen. Also kniff ich die „Backen“ zusammen damit es nicht so laut und auffällig ist. Dabei bin ich wohl etwas gerissen und hatte ganz helles Blut am Toilettenpapier. Das war meine erste richtige Panikattacke. Am Wochenende (das Pfingstwochenende) drauf hatte ich dann Kribbeln im linken Bein und Arm und beides fühlte sich extrem schwer an. Also: SCHLAGANFALL! Sofort ins KH. CT unauffällig. Blutdruck, Herzgeräusche usw. alles super! Stationär aufgenommen, alle Untersuchungen gemacht die bei Schlaganfällen üblich sind. Alles super! Ohne Befund.
Die Ärtzin sagte, dass es durch eine Panikattacke hervorgerufen wurde. So blöd wie ich war, hab ich nichts von dem Blut erwähnt. Was ich mittlerweile zutiefst bereue. Das habe ich erst bei meinem Arzt später gesagt, worauf hin er mich beruhigte, das es eine Fissur war. Kann man bei Durchfall wohl mal haben.
Danach hab ich oft tagelang nichts gegessen oder getrunken, was natürlich wieder verschiedene Symptome verursachte (Schwindel, Unterzuckerung usw.). Ich aß nichts, weil ich dachte, wenn ich was esse und ausgerechnet JETZT müßte ich ins KH und notoperiert werden, kann ich ja nichts essen, wegen Vollnarkose usw. Denn dabei muss man ja nüchtern sein.
Ich konnte nicht arbeiten. Im Büro zu sein war der pure Horror. Ich wollte nur in meinem sicheren Zuhause sein und möglichst nicht raus.
Mein 1. Arzt hat alle möglichen Tests gemacht. Kein Blut im Stuhl, keine Bakterien, Keime oder sonstwas auffälliges. Darmgeräusche normal. Magenbeschwerden habe ich selten. Blutbild supergut. Auch mein Cholesterinwert war super, trotz starkem Übergewicht. Er verschrieb mir dann Lorazepam. Das Zeug haut mich aber völlig um. Im Alltag für mich absolut nicht „Nehmbar“.
Im Sommer 2014 hatte ich eine Magen-Darm-Grippe( wahrscheinlich aus dem Kindergarten von meiner Nichte). Ich hab nach dem ganten gekotze wie ein Häufchen Elend auf dem Fussboden gekauert und hab geheult wie ein Baby. „Mein Mann war verzweifelt. Ich dachte, nun fängt es an! Nun ist beginnt mein Ende. Davon war ich zu 1000% überzeugt. Nichts konnte mich beruhigen. Nach zwei Tagen ging es mir aber wieder gut. Also doch nur ein Infekt oder sowas.
Im letzten Jahr machte ich eine Hypnosetherapie bei einem ganz ganz tollen Therapeuten. Da er aber Heilpraktiker ist, zahlt das keine KK. Heißt für mich: 150 EUR pro Sitzung. Das kann ich mir trotz relativ gutem Job einfach nicht leisten. Ich müßte mindestens einmal die Woche hin (= 600 EUR im Monat!!!)
Als ich dann nochmal wegen etwas anderem beim Arzt Nr. 1 war, hat dieser mich einfach ausgelacht. Seitdem geh ich da nicht mehr hin. Nun gehe ich wieder zu meiner „Jugendärztin“. Da war ich nicht mehr, weil man bei ihr immer so ewig im Wartezimmer sitz. Liegt einfach nur daran, dass sie sich extrem viel Zeit für ihre Patienten nimmt. Sie hat glech alle Teest (Blut, Stuhl, Urin usw.) gemacht. Alle – wie nicht anders zu erwarten – ohne jeglichen Befund. Ich hab von ihr nun Opipramol bekommen. Die soll ich Abends nehmen. Ich hoffe, es hilft.
Ärztin Nr. 2 hat gesagt, ich solle eine Magen- und Darmspiegelung machen. Sie wisse aber zu 100% das es Ergebnislos ausgehen wird. Ich weiss, dass ich diese Untersuchungen nicht schaffe aus lauter Angst. Erstens vor den Untersuchungen an sich und zweitens vor dem Ergebnis. ICH bin nämlich überzeugt, das da was ist!
In dem letzten Jahr stand meine sonst sehr glückliche Ehe mehrmals kurz vor dem aus. Mein Mann ist überfordert und weiss nicht mit mir umzugehen. Er versteht mich nicht. Wie auch?! Ich versteh mich ja nicht mal selbst. Ich hab oft Selbstmordgedanken („Wenn du es beendest, brauchst du keine Angst zu haben“). Und das will ich eigentlich nicht, Ich hab ausser meinem Mann niemanden zum Reden (wer hat auch Bock rauf mit mir über meine Sch…. zu reden?!?!). Ich bin damit völlig alleine und fühl mich trotz Ehe unglaublich einsam,
Solange ich denken kann habe ich immerwieder angst, manchmal habe ich vllt 2-3 wochen ruhe doch dann geht es direkt wieder los.Anfangs war die angst groß einen herzinfarkt zu bekommen , mein linker arm schmerzte und meine brust fühlte sich klemmend an , ich atmete schneller und ging direkt zum Arzt wo alles ok war.Später ging es mit meinen Blinddarm los ich bekamm starke bauchkrämpfe und die angst übernahm mich direkt erneut , wieder zum arzt.So in der art geht es mir andauernd.Ich rufe meine Mutter an und spreche nurnoch darüber , meine frau spreche ich ebenfals immerwieder drauf an , ebenfals mein bruder. Ich fühle mich als Nerve ich alle , oft kommt es auch so rüber als würde ich meine Familie mit meinen problemen auf die nerven gehen. Ich würde es ihnen nicht verübeln.Derzeit ist die angst vor einer Darmverengung bei mir groß , schon vor 3 Wochen zeigte sich die angst und ich bekamm auch die symptome die mir es beinahe bestätigten. Doch dann nahm ich 1 TL Lactulose und alles wurde gut , ich konnte wieder normal auf die Toilette gehen und auch meine probleme verschwanden. Dann Lezten Samstag vor 8 Tagen , ging es direkt wieder los , ich bekamm ein schmerz an meinen Schließmuskel der nicht wund brennend ist sondern einfach eine art muskel schmerz. Direkt dachte ich das ich Hämoriden habe diese machten mich aber bei weiten nicht so ängstlich. Schließlich merkte ich das ich wieder sehr schlecht auf die Toilette konnte , und am Donnerstag ass ich sehr gut , ich habe eine große mahlzeit zu mir genommen , habe etwas meine angst vergessen. Ich habe nächsten tag fest damit gerechnet stuhlgang zu haben , doch es kamm nichts. Meine angst viel förmlich über mich her und ich wuste nicht weiter , ich wurde hastig und griff dann zu Lactulose , nahm 1 TL doch dann der schock es passierte nichts. Ich ging direkt vom schlimmsten aus doch dann musste ich auf die toilette und es kamm breiig sehr klebriger stuhlgang umni etwas mehr als eine handvoll. Irgentwie war es mir nicht genug und denn tag über litt ich darunter , ich mahlte mir die schlimmsten dinge aus und es hörte nicht auf , gegen abend dann machte mich die angst so verrückt das ich erneut 1 TL Lactulose nahm , doch dann der schock , es passierte rein garnichts , ich musste zwar auf die toilette aber es kamm nur kleine portionen , diese auchnoch sehr dünn waren, als ich die Dünne ausscheidung sah die einen bleistiftstuhl ähnelt , ging in mir eine so gewaltige panik los das ich ins Krankenhaus fuhr.Der Arzt hörte mich an und sprach mit mir , er meinte das man nicht jeden tag Stuhlgang haben muss , er hörte mein bauch ab , und tastete ihn ab , doch fand nichts auffälliges , sogar mein Blutdruck war föllig normal 120/60. Er gab mir ein pulver mit was ich nehmen sollte wenn ich nach 2 Tagen kein stuhlgang hätte. Ebenfals empfohl er mir zu meiner sicherheit damit ich ruhiger werde eine Darmspiegelung zu machen damit ich sehe das alles ok ist , denn so sieht er das bereits , der Darm macht keine geräuche als würde er gegen etwas ankämpfen also einer verengung. Er machte normale verdauungs geräuche.Zuhause angekommen war ich sehr verwirrt ich fühlte mich erneut allein mit meinen problemen und wuste nicht weiter , Stuhlgang hatte ich kaum, immerwieder kammen kleine portionen.Ebenfals heute kammen nur kleine portionen und einmal gänzlich flüssig , heute habe ich 2 Pizzen gegessen so gegen 18 uhr , und schon gegen 21 uhr musste ich auf die toilette , so wieder nur sehr kleine portionen hinaus kammen die aber reste der pizza hatten , die ich mit kräuter würzte die man gut sehen konnte. Nun ich bin voller angst und ich weiss echt nicht weiter ich sitze hier und bin traurig über meiner verfassung , ich denke schon daran das ich an einer seltenen Darmverengung leide als ob es schon feststeht…
Gut zu wissen, dass ich damit nicht alleine bin! Ich bin 19, sehr jung sich überhaupt darüber sorgen zu machen. Doch trotzdem, sobald mir jemand erzählt das von einer Freundin die Mutter Brustkrebs hatte und das durch einen knubbel in der Brust festgestellt hatte, überprüfe ich es oft! Oder eine Freundin hat gutartigen Krebs in der Hand aber dennoch manchmal schmerzen, bilde ich mir sowas sofort ein, wenn ich nur ein kleines Picken im Handgelenk habe: Krebs!
Es ist manchmal echt schwierig damit umzugehen! Ich habe oft angst vor den Symptomen, versuche es zu ignorieren oder zu verdrängen und gehe deshalb nicht zum Arzt. Einmal, wegen herzrasen und Schwindel..Mir wurde Blut abgenommen und es war alles super, doch die Symptome sind immer noch da(und es kommen mehr dazu), habe auch schon mit meinen Eltern drüber geredet aber sie selbst sind überzeugt, dass ich mir das doch alles nur einbilde, deswegen gehe ich ungern zum Arzt, wegen der Angst es wird mir nicht geholfen. Meinem Psychologen hab ich es auch nicht erzählt.
Als Hyperchonda weis man ja dank internet viel über Symthome die auf schlimme Krankheiten hinweisen.. Wenn ich kleine punkte an der haut habe die anders ausshen denke ich sofort an Hautkrebs wenn ich irgendwelche drüßen oder fettgewebe an meinem körper finde denke ich sofort an tumore oder ähnliches .zb als ich mir die Bänder gerissen hatte haben die ärtze im Röntgenbild da sie vn einem bruch ausgegangen sind zwei Knochenzysten endeckt… zu meinem Glück Solitäre gutartige die keine Beschwerden bereiten, Sodas mrt. Aber ich schaue mir das bild manchmal an und das internet verunsichert mich immer wieder haben die ärtzte sich vertan? lag es ander technick oder bin ic einfachnur verrückt…. )= es macht mich fertig wenn ich allein bin denk ich offt darüber nach obwohl ich garkeinen grund dafür habe. Es tat gut die kommentare zu lesen ich hoffe es ändert sich bald. ps hat sonst noch irgenwer panische angst vor strahlung bzw handy wlan etc. danke und aufwiedersehen
Immer wieder stelle ich fest, das ich mit meinen Krankheitsängsten nicht alleine bin. Trösten tut mich das allerdings nicht. Und es hilft mir auch nicht wirklich weiter. Ich habe einiges zu verarbeiten, das weiß ich. Die Frage ist, wie tut man das. Und wenn man alles erkannt hat, wann tritt die Besserung ein. Ich fühle mich dieser Angst vor Krankheiten ziemlich hilflos ausgeliefert. Entspannungsübungen, Meditation und Ablenkung, alles ausprobiert. Seit ca. anderthalb Jahren gehe ich regelmäßig zu einer Psychologin. Ich kann nicht genau sagen, ob es mir bis jetzt etwas gebracht hat. Wenn ich mich so ansehe, dann würde ich sagen nein. Kann man Hypochondrie überhaupt heilen? Oder zumindest mildern? Die Hoffnung bleibt. Die Skepsis auch.
Liebe Frau Ohlert, bei so starken Ängsten kann eine Psychotherapie helfen. In psychotherapeutischen Gesprächen können Sie herausfinden, was Ihre Ängste bedeuten und woher Sie kommen. Wenn Sie lernen, sie zu verstehen, können solche Ängste zurückgehen. Adressen finden Sie z.B. auf http://www.dgpt.de oder auf http://www.psychotherapiesuche.de.
Viele Grüße
Dunja Voos
Hallo da draussen, es hat mich ein wenig getroestet, dass es anderen menschen auch so geht , wie mir. Bei jedem husten denke ich an lungenkrebs ( war starker raucher ) bei magenziehen a magentumor und bei darmbeschwerden an darmkrebs.
jedes pieken in der herzgegend macht mir angst vor herzinfarkt und ich habe immer gleich angst sterben zu muessen. Ich bin 62 , moechte aber noch leben. Ich fuehle mich sehr alleine, meine wenigen freunde nehmen mich nicht ernst , glaube ich, sie wollen von krankheiten nichts wissen.
ich habe schon viele untersuchungen gemacht und es wurde nichts gefunden.
trotzdem gabe ich herzrasen und gerzstolpern und angst.
dann hilft mir nur eine beruhigungstablette. Was soll ich tun ??? Liebe gruesse
Es tut gut Euch hier zu lesen. Ich hab es wohl auch und weiss mir noch nicht richtig zu helfen. Ich wurde vor 2 Jahren an der Brust operiert, am Ende war es harmlos- laut Labor, aber in meinem Kopf blieb die Angst. Ich habe fast täglich eine andere Krebsdiagnose und war schon diverse male in der Röhre, aber gefunden hat keiner etwas. Jedes mal denke ich „die haben nicht richtig geguckt“ und gehe zu einem anderen Arzt.
Meine große Panik ist nicht der Tot, denn wenn ich tot bin, dann merck ich es ja nicht mehr, aber meine Töchter sind noch im Kindergarten und ich werde fast wahnsinnig, bei dem Gedanken, dass ich sie hier alleine lassen muss… Obwohl sie es sicher schaffen würden, denn der Vater ist ja auch hier..dennoch. Es ist wohl die Verantwortung, die auf mir lastet und die mich so in die Enge treibt. Ich weiss nicht, wie und wo ich mir Hilfe holen soll, aber dass ich etwas tun muss ist klar. Ich habe meinen Lebenswillen verloren, das Gefühl von Vertrauen und Glück ist fort und das Ergebnis ist eine strenge Mutter, die immer gestresst und angespannt ist, dass wollte ich nie sein…ich bin mir selbst so fremd geworden und finde den Faden zu mir nicht…
Ich wünsche mir und Euch was ich am wenigsten empfinde : Glück und Vertrauen!!
Die Angst vor der Angst
Bei mir hat das ganze vor etwa 4 Jahren angefangen. Ich bin immer gerne mit dem Flugzeug geflogen. Es war der Rückflug aus der Türkei nach Hause. Der Flieger steht auf der Startbahn, ca. 4 min vor dem Start. Mein Puls ist gestiegen, dass Herz fühlte sich an, als ob es immer stärker und fester schlägt und ich spürte es in meiner ganze Brust. Es war ein extrem beunruhigendes Gefühl und ich bekam Panik und ich wollte raus aus dem Flieger. Ich hatte Angst davor, etwas ist mit meinem Herz, wenn ich gleich in der Luft bin kann mir niemand mehr helfen. Mein Mund und meine Lippen waren so trocken. Meinen Fensterplatz wollte ich verlassen und mich gegen den willen der Stewardessen an den Gang setzen. Alle im Flieger schauten auf mich (wobei ich das noch nicht mal bemerkt hatte und es später erst erzählt bekommen hatte, da ich nur mit mir selbst beschäftigt war). Ich tauschte mit meiner Frau und ihrer Sitznachbarin den Platz, sodass ich im Gang sitzen konnte. Die Panik und Angst war immer noch da und ich dachte, dass etwas mit meinem Herz ist. Links neben mir, also die Sitzreihe neben neben dem Gang saß ein junger Mann mit seinem etwa 4 Monate alten Baby auf dem Schoß. Diese Person hatte ich vorher nie zuvor gesehen, oder gekannt. Er hat mir sein Baby gegeben und ich war nach ca. 5-10 Minuten komplett abgelenkt und nur auf das Kind fokussiert.
Danach fingen dann so langsam die Arztbesuche an. Zuerst zu meiner Hausärztin. Eine 24 std. EKG Messung erfolgte. Ergebnis: alles Tip Top. Die nächste Untersuchung: 24 Std. Blutdruckmessung. Da war auch wieder alles ok! Irgendwann dachte ich mir, dass Sie vielleicht etwas übersehen hat und ich redete mir immer ein das ich doch was haben muss, aber Sie nichts gefunden hatte. Dann bin ich zu einem anderen Arzt um ein Belastungs EKG machen zu lassen. Hier war natürlich auch alles bestens. Er hat noch ein großes Blutbild mit Schilddrüsen machen lassen. Alle Werte Top! Nächstes Ziel war dann die Uniklinik in Mainz, wo ein Ultraschall von meinem Herz gemacht wurde. Das Ergebnis war auch alles Top. Wobei der Arzt gesagt hatte, dass ich unter einer sogenannten Neurose leiden würde. Ich konnte mir nichts darunter vorstellen und hatte es dann gegoogelt. Das alles was dort gestanden hatte, habe ich schon verstanden, nur habe ich mich nicht damit abgefunden das ich ein Psychische Störung habe. Es muss irgendetwas Körperliches sein!
Mittlerweile bin ich zwei mal aufgrund einer Panikattacke in die Notaufnahme im Krankenhaus gekommen. Es waren immer wieder die Gleichen Symptome wie im Flieger, nur war es so schlimm, dass ich es nicht mehr unter Kontrolle hatte. Nach ca. 2 std, sämtlichen Untersuchungen bin ich dann wieder entlassen worden. Die Ärzte sagten mir: SIE HABEN NICHTS !!!!
2014 hatte ich über einen Zeitraum von ca. 2-3 Wochen Kopfschmerzen, zwicken und ein ziehen im Kopf. Irgendwann dachte ich, ich habe einen Tumor und habe mich immer mehr reingesteigert. Ab zum nächsten Arzt, ein Neurologe. Der hat die Gehirnströme gemessen und mich komplett untersucht. Das Ende vom Lied: ich bin in die Röhre gekommen, CT von meinem Kopf wurde gemacht. Der Befund: Nichts und wieder nichts. Ich bin Gesund und das muss ich mir jetzt endlich mal einprägen!!!!
Ich muss auch sagen, dass ich schon immer viel und gerne Sport gemacht hatte. Aufgrund meiner Angst, habe ich keinen Sport mehr gemacht, weil ich dachte, dass durch die Belastung beim Joggen irgendwas mit meinem Herz sein könnte.
Immer und immer wieder plagten mich Panikattacken auf der Arbeit und ich wusste nicht immer damit umzugehen und ich hatte immer nur eine Große Angst, dass ich sterben könnte. Irgendwann bin ich dann wieder zu meiner Hausärztin und habe mich auf eigenen Wunsch in das Krankenhaus einweisen lassen, wo sich eine Abteilung mit dem Namen „Akutpsychosomatik“ für 2 Wochen gekommen bin. Dieser Aufenthalt dort hat mir sehr geholfen und es wurde eine Angst- bzw. Panikstörung bei mir diagnostiziert.
Folgendes habe ich gelernt: mache regelmäßig Sport, um deinem Körper und deinen negativen Gedanken zu zeigen, dass alles okay ist. Weg von dem Vermeidungsverhalten !! Ganz wichtig war, dass ich permanent Stress auf der Arbeit hatte und nie entspannen konnte. Schreib dir in Deinen Kalender einen Termin für Abends rein. Der Termin ist mit dir selbst, nimm dir Zeit für Dich selbst. Entspanne, mach Entspannungsübungen (PMR, Phantasiereise usw), mach das was dir Spaß macht, gehe spazieren, lies ein Buch.
Es war immer ein ganz schmaler Grad zur Panikattacke, die wurde durch verschiedene Sachen ausgelöst. Stellt euch eine Wanne vor, die mit vielen Dingen gefüllt ist: wenig Schlaf, ungesunde Ernährung, Stress, Alkohol, usw… Die Wanne ist schon komplett damit gefüllt und somit kann eine Tasse Kaffee dazu führen, dass die Wanne überläuft und dadurch Angst und Panik ausgelöst werden. Natürlich können viele andere Dinge auch der Auslöser sein.
Heute kann ich gut damit leben. Rückschläge kann man immer wieder haben. Wichtig ist es, sich davon nicht runterziehen zu lassen. Steigt aus dem Kreislauf der Angst aus, denn negative Gedanken verstärken die Angst umso mehr.
Wichtig ist: ein gesunder Schlaf, Sport und eine gute Ernährung und weniger Stress. Wenn es nicht mehr geht auf der Arbeit, dann wechselt eben den Job. Ich habe es auch getan!
Heute helfe ich anderen Menschen gerne weiter, die mit Ängsten und Panik zu tun haben, da ich weis wovon ich spreche, denn ich habe alles selbst erlebt und durchgemacht.
Hallo
Meine hypochondriekariere hat im jahr 2001 begonnen,gleich nach der geburt von meinem Sohn (war ein traumageburt) diese angstphase hielt damals ca.2 jahre lang, ich ging auch zum hunderten ärzten. Eine zeit lang war mal ruhe,dann gabs wieder phasen wo ich extreme angst habe an HIV zu erkranken,habe mich soviel ich noch weiss 3x testen lassen, ergebnis > Negativ!!
Jetzt meine Hypochondrie hat mich wieder mal und diesmal schwer erwischt!!angefangen hat das ganze wieder nach der geburt von meine Tochter sie ist 8 mo alt (per kaiserschnitt)danach wundheilungstörungen) vor 2 mo wurde bei mir einen gastritis typ C bei eine Magenspiegelung diagnostiziert und ein kleiner polyp im darm wurde bei eine darmspiegelung entfernt (gutartig) . Ich ging damals zur gastro und colo da ich seit 10 jahren blut im und am stuhl habe,und habe das ganze einmal durchchecken lassen um das gewissheit zu erlangen woher das blut kam… arzt meinte es ist alles ok. Zuerst brachte mir die untersuchung gewissheit,tja aber nur für eine kurze zeit,3 tage später hat mich wieder meine selbstzweifel zerfressen, meine hypochondrie highlight ist erreicht,ich ging zu mehreren ärzten und wechselte auch 1000x,da ich der Meinung bin,die sind nicht Kompetent genug,oft gehe ich auch zu einem privat Ärzten,mit d.Glauben endluch ernst genommen zu werden bzw.mal gescheitt untersucht zu werden,tja es war alles nur eine Einbildung,ich soviel Kohle dafür ausgegeben und habe nicht einmal eine gescheiten Arzt gefunden.,bis jetzt bin ich immer noch auf der suche nach einem Arzt den ich Vertrauen kann,der mich ernst nimmt und mich auch ordentlich durchcheckt!
Ich habe extreme angst an irgendwelchen sxhweren Krankheit zu erkranken ,besonders an Krebs,da ich ja die Gastritis habe,um so mehr scheisse ich mich an,da ja das Risiko einenMagenkrebs zu bekommen bei Gastritis hoch ist. Ich mache mir auch nebenbei gedanken ob der Arzt der bei mir d. Gastro und colo gemqcht hat ja nichts übersehen hat und habe sogar mit der Gedanken gespielt den selben Untersuchungen zz machen,und zwar bei einem anderen Arzt,war sogar gewillt es selbst zu bezahlen…
Und am meisten habe ich grosse angst zu sterben,ich kann nicht mehr an was anderes denken ausser an Krebs und Tod und meine Kinder zuverlassen wäre für much schlimmer als der Tod (ich bin 34 j.)
Sorry für meine Rechtsschreibt und grammatik Fehler aber rechtsschreibfehler hin oder her,wir haben alle eins gemeinsam…wir sitzen alle auf d.selben Boot..
Ich wünsche meine mitleidenden VIEL KRAFT und wünsche uns allen dass wir 100j alt werden (natürlich ohne körperlichen gebrechen)…
Ich fand diesen Beitrag sehr hilfreich.
Ich bin 19 Jahre jung und eigentlich ein sehr gesunder Mensch.
Ich habe vor ein paar Monaten bemerkt das ich immer wieder unter der Angst leide Krebs, einen Herzinfarkt oder sonstiges zu erleiden.
Ich denke es liegt daran dass ich vor nicht all zu langer Zeit meine bisher größte liebe verloren habe, sie hat mich für einen anderen verlassen, und ich fühlte mich seither sehr schlecht.
An manchen Tagen geht es mir gut und an anderen kann ich nur an den Tod denken, aus Angst.
Seit ich alleine bin fühle ich mich überhaupt nicht mehr sicher den ich habe das Gefühl mir selbst nicht sorgen zu können.
Die ganze Sache verschlimmert sich nun auch noch dadurch das ich länger wie depressiver werde und den Hang zur Realität verliere, ich fühle mich ungeliebt und sterbe jeden tag in meinem Kopf.
Nicht einmal mehr der Konsum von Cannabis hilft mir mich abzulenken, eher macht es meine Angst vor kreislauf Ausfällen noch schlimmer.
Bis ich diesen Artikel gelesen habe wusste ich um diese Erkrankung nicht Bescheid und ich fühle mich für den Moment etwas sicherer.
Ich hoffe nur das diese Qual bald aufhört denn so ist das leben nicht lebenswert.
Danke für diesen Artikel. Ich bin 41 Jahre alt und leide seit gut 3 Jahren an regelrechten Angstattacken und die Panik zu sterben, schwer krank zu sein oder, dass mir irgendetwas schlimmes passiert. Mir geht es genau so wie die Anderen, welche Kommentare hier reingestellt haben. Arztbesuche ohne Ende….Seit paar Wochen gehe ich zum Heilpraktiker und werde im November dort eine Aufstellung machen lassen. Ich hoffe, dass ich die Ursache dieser ständigen Angst finden werde, denn die Lebensqualität und Freude am Gesundsein leidet sehr darunter. In meiner Familie gab es keine krankheitsbedingten Sterbefälle, also kann es daran nicht liegen. Der Artikel öffnet mir die Augen und ich hoffe, dass ich hier ansetzten kann.
Viel Glück für alle Mitleidenden, wir werden hoffentlich alle den richtigen Weg finden.
Ich bin 17 und vor 5 Jahren ist meine Mutter an einem Hirntumor gestorben. Sie hat 5 Jahre lang gelitten, bis sie erlöst wurde, da war ich 12 . Ich habe also die krankheit Krebs und ihre Ausmaße voll miterlebt, bin sozusagen damit aufgewachsen. Auch meine Oma und meine uroma hatten Krebs, den sie aber überlebt haben. Vielleicht ist das der Grund, warum ich mit 15 Jahren angefangen habe, Angst zu bekommen, selbst an krebs zu erkranken. Inzwischen hat es sich auch auf andere Krankheiten ausgeweitet und ich habe manchmal das Gefühl, ich werde verrückt. Helfen tut mir nur Ablenkung, Sport und gesunde Ernährung fürs Gewissen. Ich war auch schon einmal bei einer Psychologin, die war aber nichr so kompetent und ich habe mich nicht so wohl gefühlt. Außerdem weiß ich, dass ich gesund bin und nur diese blöde Angst sich nicht abstellen lässt. Der Text hat mir gezeigt, ich bin nicht bescheuert und auch die Kommentare haben dazu beigetragen. LG
Diesen Text zu lesen tat richtig gut, er hat mich (ein wenig) beruhigt…. Ich bin selbst noch jung (25 Jahre) und lebe seit Jahren immer wieder mit der Angst etwas Schlimmes zu haben. Aus jedem Kopfschmerz wird ein Hirntumor, aus jedem Kratzen im Hals oder einem „komischen“ Gefühl beim Atmen Lungenkrebs. In klaren Momenten weiss ich dass ich überreagiere und dass das Quatsch ist, aber während dieser Angstattacken bin ich zu 100% davon überzeugt dass ich etwas ganz Schlimmes habe und bald daran sterbe. Ich wusste nie wie ich mir helfen soll. Mittlerweile denke ich dass ein Psychotherapeut vielleicht wirklich die beste Entscheidung wäre. Ich kann mir den Grund für meine Angst ja schon denken, ich bin eigenlich eine intelligente junge Frau. Meine Mutter starb an Krebs als ich 19 war…
Mit Hypochondrie ist nicht zu spaßen.. jahrelang hatte ich das. Ständig diese enorme Angst krank zu sein, ausgelöst wurde dies bei mir auch durch einen Todesfall. Man wird sich in diesem Moment bewusst wie schnell das Leben doch vorbei sein kann und plötzlich denk man man wäre es selber und jeden Moment fällt man tot um.. Bin jetzt schon einige Jahre bei einem Psychologen und mache regelmäßig eine Selbsthypnose. Immer wenn ich merke es kommt eine Panikattacke hoch oder ich bilde mir wieder viel zu viel ein höre ich die Hypnose gegen Angst, eine Selbsthypnose, die habe ich mir vor einiger Zeit bei Amazon geholt, ich entspanne dabei und vergesse alles um mich herum, bin in Trance. Danach fühlt man sich gleich wieder besser, ich fühle mich danach gesund und habe keinen Grund mehr mir was einzubilden. Das Thema ist eine schwierige Sache und alle halten einen für vollkommen durch den Wind..
Ich denke ich habe im Moment Ängst die in Richtung einer Hypochondrie gehen können und finde es fast schlimmer, als tatsächlich krank zu sein.
Ich habe nun seit 2 Jahren unter Vorhofflimmern (VHF) gelitten, einer Herzrythmusstörung, die so an sich erst mal nicht lebensbedrohlich ist, aber die Lebensqualität mindern kann. Mein Herz wurde mehrmals durch die Röhre geschickt. Es ist kerngesund, ich bin erst 27 Jahre alt und körperlich fit.
Das VHF habe ich durch eine Ablation entfernen lassen vor etwa 8 Wochen. Doch seid dieser Zeit keimt die Angst auf, dass das VHF bei mir doch nicht durch einen zufälligen Gendefekt, sondern eine Organschwäche gekommen sein könnte. Jeder Armschmerz wird zum Herzinfarkt, jeder Schwindel, jedes ziehen oder Picken in Brust und oberem Rücken ist ein unentdeckter Herzfehler. Die darauf folgende Panikattacke mit Schweißausbruch und Muskelkrampf ist dann natürlich auch ein Miniinfrakt anstatt einer Attacke.
Hinzukommt, dass mein Onkel, Mein Opa, mein Uropa, mein Großonkel, alles aus einer Verwandtschaftslinie an Herzversagen starben, alle relativ früh. Aber die haben auch gefressen / gesoffen / geraucht bis zum geht nicht mehr…
Ich versuche das in den Griff zu bekommen. Ich weiß:
1) Das mein Herz gesund ist. Mehrere Bildgebungen, mehrere Ärzte haben das unabhängig voneinander bestätigt
2) Ich geh ins Fitnessstudio. Dort bin ich abgelenkt und habe KEINE Symptome. Und meine Pumpe tuts. Ich kann wie gewohnt meine Leistung dort abrufen. Das ginge nicht, wenn was kaputt wäre
3) Ich vermeide es über Krankheiten im Internet zu recherchieren. Das macht mir nur Panik.
4) Ich kann autogenes Training und versuche damit mich auf andere Dinge zu Konzentrieren.
Falls das nicht funktioniert, werde ich mit meinem Arzt über das Problem reden und im Zweifel muss eine Therapie sein.
Ja… Ich muss auch sagen, es geht mir schrecklich.
Ich bin von Beruf Sänger und leide leider ständig unter chronischer Laryngitis(Kehlkopfentzündung).
Ich war bei verschiedensten Ärzten, in letzter Zeit geht es mir schlechter, obwohl zwischenzweitlich eine Besserung aufgetreten ist. Ich bin leider in meinem Kopf durch meine größte Angst, meine Stimme zu verlieren, furchtbar stark darauf gepolt, dass es Kehlkopfkrebs sein muss.
Es ist schrecklich, ich kann nicht schlafen, wache mitten in der Nacht mit Panikattacken, kann nicht mehr schlafen.
Auch meine Freundin leidet darunter sehr, glaube ich.
Sobald ich unter einer der Attacken leide, bin ich leider auch für niemanden ansprechbar, bzw. höre niemandem zu.
Ich kann langsam nicht mehr, es ist wirklich ätzend.
Diese Ängste zerstören einfach mein Leben. Ich kann nichts mehr genießen, bin ständig unter Stress.
Ich hoffe sehr, dass eine Therapie mir hilft.
Ein Freund von mir leidet auch stark darunter. Das ging so weit, dass er sogar regelrechte Panikattacken bekommen hat, die manchmal bis zu einer leichten Asthmaattacke führen konnten.
Jetzt ist er schon länger in psychologischer Behandlung und seitdem geht es ihm wesentlich besser. Aber das Wichtigste ist und bleibt, dass er weiß, dass er sich auf die Familie und gute Freunde stützen kann, die ihm immer zur Seite stehen.
Meine sehr gute Freundin erkrankte Ende 2009 an Krebs – Bauchspeicheldrüsenkrebs. An diesem Tag ging mein Leben den Bach runter.
Als sie daran erkrankte und mir ihre Symptome beschrieb fing ich an, bei mir nach diesen Symptomen zu suchen.
Und ich hatte tatsächlich einige davon.
So steigerte ich mich immer mehr rein, krank zu sein.. In Spitzenzeiten der Hypochondrie hatte ich alle fünf Minuten eine andere Krebserkrankung, in dieser Zeit dachte ich auch oft über Selbstmord nach.
Diese Gedanken trieben mich in den Wahnsinn.
Im April 2011 starb meine Freundin dann. Zu dem Zeitpunkt war meine Krankheitsangst zwar noch vorhanden aber lange nicht mehr so schlimm, wie damals.
Ich mache seit August eine Therapie bei einer Psychologin.
Ich habe erst verstanden, dass ich Hilfe brauche, als sie gestorben ist, das war für mich der Anlass, ohne Hilfe, kann ich nicht mehr. Ich war total am Ende, hatte mehrere Zusammenbrüche.
Hypochondrie macht einen einfach fertig!
Mitlerweile geht es, Angst habe ich nicht mehr oft, auch nicht mehr so arg wie früher, aber wenn ich sie habe, dann siegt sie leider mehr, als mein Verstand.
Aber da bin ich guter Dinge und das bekomme ich auch noch hin.
Heute ist übrigens meine Freundin 8 Monate lang tot. Rest in Peace & euch ein frohes Weihnachtsfest!
Das Vertrauen in den eigenen Körper wieder zu erlangen, im Grunde Punkt 9 halte ich für enorm wichtig, um mit seiner Hypochondrie fertig zu werden. Mir hat beispielsweise regelmäßiger Sport dazu verholfen, wieder mehr Vertrauen zu erlangen.
Heute bin ich meine Hypochondrie im Großen und Ganzen los, wobei hypochondrische Tendenzen manchmal wieder aufflammen, wenn es mir mal nicht so gut geht.
Heute weiß ich damit umzugehen. Hypochondrie ist wahrlich kein Zuckerschlecken!
Viele Grüße.
Es gibt keine Hypchondrie, sondern nur unfähige Ärzte. Leider viel zu viele von Ihnen. Es gibt villeicht Patienten die überreagieren, und ein kratzen im hals überberwerten, aber dennoch bleibt die Tatsache, das ein kratzen vorhanden war. Nur macht sich keiner die Mühe tiefer nachzusehen, was der grund war, wenn man oberflächlich nichts zu sehen ist. Wie der Fall einer Frau, die wegen ständigen räuspern und Atemnot bei zig ärzten war und von allen als Hypochonder abgetan wurde, bis sie eines Tages so stark hyperventilierte (hauptsächliche in Panik) das sie schliesslich einen Atemstillstand hatte. Sie wurde gerettet. Und man fand ein Reinke Ödem, nicht gross und nicht ausgeprägt um wirklich Erstickungsanflle hervorzurufen, aber eben doch gefährlich genug um einen empfindlichen Menschen so derart zu behindern und in panik zu versetzen, das es fast zum tode führte… Es gibt keine Hypochonder sondern nur besonders empfindsame menschen, für die schon die kleinste körperliche Veränderung zu problemen führen kann. diese Ursach zu finden ist die aufgabe der ärzt und nicht – wenn man nichts findet – die person als hypochonder abzutun.
http://www.tomsbay.de
Danke für diesen Artikel! Nach einer Hautkrebserkrankung im Jahr 1994, die vom ersten Arzt nicht erkannt wurde, habe ich jahrelang unter Hypochondrie gelitten. Da wieder raus zu kommen hat mich Jahre gekostet und wenn ich nicht einen so geduldigen und konsequenten Hausarzt hätte, wäre mir das allein sicher nur schwer gelungen.
Mir haben regelmäßige Check-Ups gegen die Angst geholfen, gegen die Pankiattacken spezielle Atemtechniken und progressive Muskelentspannung.
Genau wie im Artikel beschrieben bemühe ich mich heute darum, eine logische Erklärung für eine (vermeintliche) Symptomatik zu finden.
Das Hauptproblem liegt darin, sich selbst als Hypochonder zu erkennen. Bis zu dieser Erkenntnis war ich nämlich jahrelang der Überzeugung, die behandelnden Ärzte seien nur nicht gründlich genug, die eingebildete Erkrankung zu diagnostizieren.