



Wenn ein Baby nach echtem sozialen Kontakt sucht, nach Berührung und nach der Stimme der Mutter, dann hat es so etwas wie eine „Schablone“ in sich, in die die passende Berührung und Stimme hineingelegt werden soll. Es „weiß“ sozusagen, wie der andere zu sein hat, um zu befriedigen. Der norwegische Soziologe Stein Braten hat hier den Begriff des „virtuellen Anderen“ gesprägt, den der Säugling sozusagen in sich trägt oder den er sich auf gewisse Weise spürt. Wenn die Mutter sich dann von außen nähert und mit dem Säugling im passenden Ton spricht, dann empfindet der Säugling tiefe Befriedigung. Die Mutter entspricht dann dem „virtuellen Anderen“, der zuvor im Säugling war. Weiterlesen
Der Begriff „La belle indifférence“ wurde ursprünglich für die Hysterie verwendet. Auch heute taucht er bei der Konversionsstörung auf, wenn ein körperlich-symbolisches Symptom entsteht wie z.B. eine Lähmung oder eine (vorübergehende) Blindheit. Trotz offensichtlich schwerer körperlicher Beeinträchtigungen zeigen sich die Betroffenen kaum besorgt. Wir alle kennen vielleicht auch diese „schöne Gleichgültigkeit“, die uns befällt, wenn wir vom Tod eines nahen Angehörigen hören oder wenn wir in einer psychisch schwer aushaltbaren Situation stecken, z.B. wenn wir merken, dass wir gerade durch eine Prüfung fallen oder sehr kritisiert werden. Dieses Gefühl der Gefühllosigkeit ist angenehm und einlullend. Es ist wie ein Zuhause in einer unbarmherzigen Welt. Weiterlesen
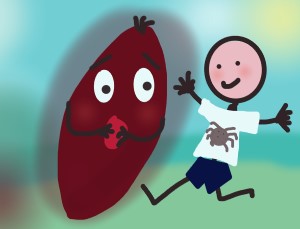
Die Amygdala, zu deutsch „Mandelkern“, ist ein uralter Teil des Gehirns. Eine schöne Abbildung findet sich hier (Mr. Barlow’s Blog: „No amygdala, no fear“ – „Keine Amygdala, keine Angst“, was übrigens nicht ganz stimmt). Die Amygdala ist für unsere Gefühle zuständig. Hier entstehen Gefühle, hier werden sie teilweise gesteuert. Die Amygdala startet zum Beispiel „Alarmreaktionen, noch bevor das Großhirn darüber nachzudenken in der Lage ist“ (Wettig 2009). Sie nimmt Sinneseindrücke und Empfindungen auf, speichert sie und leitet sie an das Großhirn weiter. Weil die Amygdala eng mit anderen Hirnteilen, wie z.B. dem Hippocampus, verbunden ist, setzt sie auch körperliche Reaktionen in Gang, die die Gefühle begleiten – dazu gehören zum Beispiel Pulsveränderungen, Veränderungen der Muskelspannung oder auch Veränderungen der Verdauung. Weiterlesen
Wir kennen eine große Palette an Gefühlen: Angst, Trauer, Freude, Neid, Lust, Liebe, Hass, Ärger. Aber ein Gefühl, für das wir keinen gebräuchlichen Namen haben, ist aus meiner Sicht eine Art „Tiefegefühl“. Es ist ein Gefühl, als würde man in sich selbst hineinfallen. Es entsteht zum Beispiel, wenn wir einen Unfall sehen, wenn wir in der ersten Nachthälfte tief träumen (also nicht, wenn wir gegen Morgen luzide träumen), wenn wir ein kurzes Gefühl des Unheimlichen haben, wenn wir eine gefühlt „telepathische Begegnung“ haben, wenn uns jemand seinen Traum erzählt oder vielleicht, wenn wir „psychotisch“ sind. Es ist das Gefühl, das entsteht, wenn für Momente (sozusagen bei vollem Bewusstsein) das Bewusstsein ausgeschaltet ist oder zu sein scheint. Weiterlesen
Wenn wir „passiv-aggressiv“ sind, dann haben wir in der Regel Angst vor unserem Gegenüber. Wir wollen etwas erreichen, gehen aber vielleicht davon aus, dass der andere sowieso „Nein“ sagen wird. Wir sind wütend auf den anderen, aber wir meinen, seine Verletzlichkeit zu spüren, und sagen dann vielleicht übertrieben freundlich, was wir wollen oder denken. Vielleicht beneiden wir den anderen sehr, aber wir lieben ihn auch und dann überkommen uns Kopfschmerzen, sodass der gemeinsam geplante Konzertbesuch ins Wasser fallen muss. Unser Kind reißt uns nachts mit Fieber aus dem Tiefschlaf, doch weil wir es in so einem Zustand nicht anblöken können, sprechen wir mit fiepsig-freundlicher Stimme zu ihm, die aber irgendwie Ärger auslöst. Weiterlesen
„Das ist nur eine Panikattacke – daran sterben Sie nicht“, sagen Ärzte manchmal lapidar. Doch wieso fühlt der Patient es so anders? Wer als 20-Jähriger eine Panikattacke erleidet, der stirbt mit höchster Wahrscheinlichkeit nicht daran. Doch wer ein psychisches Leiden hat, das immer wieder von Panikattacken und Spannungszuständen geprägt ist, der ist in der Tat gesundheitlich schwer belastet. Panikattacken und Herzinfarkte lassen sich gerade bei Frauen häufig kaum voneinander unterscheiden. Mehrere Studien weisen darauf hin, dass Panikattacken auf Dauer eben doch zu schwerwiegenden gesundheitlichen Folgen führen können. Die Betroffenen stellen sich die Frage, wie sie damit leben können. Weiterlesen