



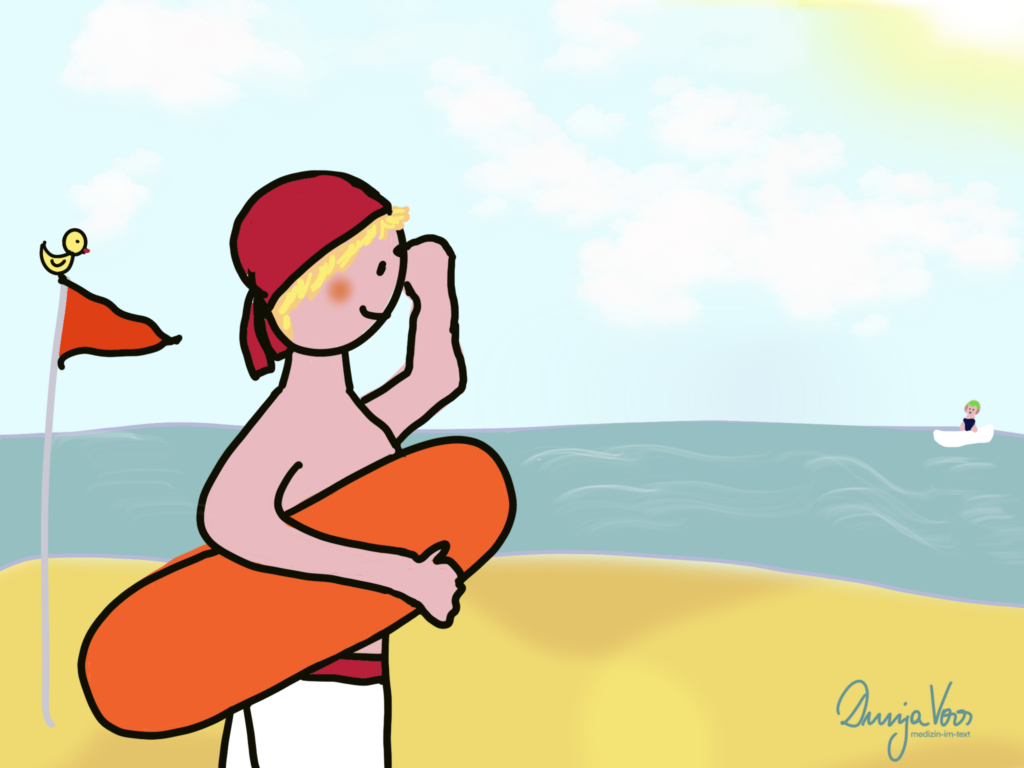
Je schwerer eine Erkrankung, desto größer manchmal die Retterphantasie, könnte man vielleicht sagen. Ärzte, die mit dem Defibrillator zum Herzkranken laufen, sind – je nach Situation – hoch motiviert und wollen helfen. Schaffen sie es, so haben sie den Patienten gerettet. In der Psychotherapie- und Analyse-Ausbildung lernen Kandidaten oft, dass sie sich vor der Retterphantasie hüten sollten. Doch auch in der Psychotherapie kann man sich durch psychisch schwer kranke Patienten besonders herausgefordert fühlen. Da sich mehr oder weniger bewusste Retterphantasien nicht „verhindern“ lassen, ist es wichtig, sie zu bemerken. Eine Retterphantasie kann z.B. als Gegenübertragungsphantasie oder -Gefühl auf einen Patienten entstehen, der selbst einen „Größenwahn“ hat.
Wenn der Psychotherapeut oder Psychoanalytiker sich stark fühlt und große Hoffnungen in die Therapie legt, kann es sein, dass er den Patienten damit regelrecht „überfährt“. Therapeuten, die sich besonders schwungvoll in der Therapie eines schwer kranken Patienten fühlen, sollten sich fragen, ob dieses Gefühl von Kraft nicht auch eine Form der Abwehr von Hilflosigkeit sein kann. Es kann jedoch auch etwas Altbekanntes darstellen: Hier der „mächtige Therapeut“ und da der sehr schwache, hoffnungslose Patient – diese Konstellation ist vielleicht etwas, das der Patient gut kennt. Vielleicht gab es zwischen Mutter und Kind die gemeinsame Phantasie, dass die Mutter besser wüsste, wie es ihrem Kind ginge als das Kind selbst. Statt Empathie gab es in einer solchen Beziehung nur eine gefühllose Überzeugung.
„Dem Patienten ging es erst besser, als ich selbst meine Hoffnungslosigkeit zum Ausdruck brachte“ – so oder ähnlich las ich es einmal von einem psychoanalytischen Autor (die Quelle kann ich leider nicht mehr finden), doch erscheint es mir logisch: Das Gegengewicht zum „Größengefühl“ des Psychotherapeuten ist vielleicht manchmal die „maligne Regression“ des Patienten. Vielleicht bedingt auch das Eine das Andere. Viele Menschen haben wohl einen „Retter“ in ihrer Vorstellung. „Ohne meinen Chirurgen würde ich heute nicht mehr leben“, sagen manche. Oder: „Ohne meinen Lehrer hätte ich nie aus meiner hoffnungslosen Lage herausgefunden“, sagen wir vielleicht.
Wenn wir einen schwer kranken Patienten psychotherapeutisch behandeln, lohnt es sich, sich damit auseinanderzusetzen, was „Rettung“ für einen selbst eigentlich bedeutet. In den meisten Märchen gibt es eine Rettung. Der Prinz, der die junge Frau von der bösen Mutter wegführt, ist ein Retter. Das „Väterliche“ verbinden wir nicht selten mit etwas Rettendem, denn das „Väterliche“ stellt das „Dritte“ dar – den Ausweg aus einer vertrackten Zweiersituation. Wenn wir nicht wissen, ob wir A oder B wählen sollen, dann kann C die Lösung sein. Sich als „Retter“ zu fühlen, kann auch bedeuten, sich mit dem Vater des Patienten zu identifizieren, der dem Patienten vielleicht heraus aus der engen Beziehung mit der Mutter verholfen hat.
Auf die Frage, warum man sich als Psychotherapeut oder Analytiker wie ein Retter fühlen kann, gibt es wahrscheinlich viele Antworten, die bei jedem Therapeuten-Patienten-Paar anders aussehen mögen. Die Retter-Phantasie zu verdrängen würde bedeuten, ein wertvolles Gefühl aus dem Verstehen herauszulassen. Die Retterphantasie kann als Kompass dienen. Der tiefe Fall nach einem verlorenen „Rettungsversuch“ kann auch eine Schule auf dem Entwicklungsweg zum Psychotherapeuten/Psychoanalytiker sein. Die Enttäuschung verhilft zu einer mehr demütigen Haltung und vielleicht einer realistischeren Einschätzung von Patienten und der Möglichkeit der Psychotherapie/Analyse. Und doch ist es vielleicht wie mit dem Verlieben: Jeder neuen therapeutischen Beziehung liegt ein Zauber inne, der wieder neue Erfahrungen mit sich bringen wird.
Transference:the Saviour, the Madonna and the Slut
Centre Of Applied Jungian Studies
https://appliedjung.com/transference/
Emanuel Berman (1993):
Psychoanalysis, Rescue and Utopia
Utopian Studies, Vol 4, No. 2, 1993: 44-56
https://www.jstor.org/stable/20719959