



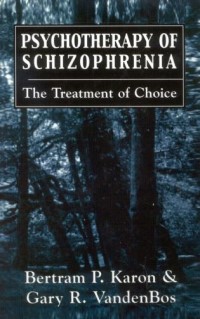
„Der Psychotherapeut, der Patienten mit schizophrenen Psychosen behandelt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass es bei diesen Patienten hauptsächlich um’s Überleben geht“, schreibt Bertram Karon (1930-2019) in seinem wunderbaren Buch „Psychotherapy of Schizophrenia“ (Bertram Karon und Gary Vandenbos, Rowman&Littlefield Publishers 2004: S. 204, 1981, 1994 by Jason Aronson Inc.). Bei der schizophrenen Psychose leiden Patienten unter Stimmenhören, Wahnvorstellungen (z.B. „der andere will mich umbringen“, „ich werde verfolgt“) und – seltener – unter optischen Halluzinationen. Bertram Karon verstarb 2019 – er gilt als einer der versiertesten Psychoanalytiker auf dem Gebiet der Psychosen.
Unter „Psychose“ versteht man das Auftreten von Wahrnehmungen und Gedanken, die aktuell nicht realistisch sind. Beispiel: Bei einer Depression mit psychotischen Symptomen leidet ein gut situierter Patient vielleicht unter einem Verarmungswahn oder er fühlt sich von anderen ständig abfällig angeblickt. Ob man einen Patienten als „schizophren“ oder „psychotisch“ bezeichnet, ist oft schwer zu sagen. Mit „Psychose“ ist oft der akute vorübergehende Zustand gemeint, während bei der Schizophrenie oft ein „zäher“ Verlauf mit Negativsymptomen vordergründig ist. Und selbst an der Frage, ab wann man einen Patienten als „psychotisch“ bezeichnet, scheiden sich die Geister (siehe Unterschied zwischen Schizophrenie und Psychose).
Hierzulande werden meistens einfach Medikamente gegeben – häufig aus Hilflosigkeit und Unwissenheit, weil entsprechende psychotherapeutische Techniken nicht gelehrt wurden und Zeit und Geld für die psychotherapeutische Behandlung fehlen. Bertram Karon ist ein Verfechter der medikamentenfreien Behandlung der Schizophrenie. Er ist der Überzeugung, dass Medikamente das Bild verfälschen und den Zugang zum Patienten erschweren. Er hat die Erfahrung gemacht, dass man den Patienten psychotherapeutisch erreichen kann, egal wie akut oder chronisch psychotisch er gerade ist. Er hat ein tiefes Verstehen für seine Patienten. Er schreibt, dass die Hauptaffekte bei der schweren psychischen Störung „Angst und Ärger“ sind.
„Die Patienten leiden so sehr unter Hass und Wut, weil sie in der Vergangenheit so schwer verletzt wurden“, erklärt Bertram Karon.
Er rät dem Psychotherapeuten, auf die Emotionen Angst und Ärger einzugehen. Wenn ein Patient halluziniert, dann könne man dieses Phänomen behandeln wie einen Traum. Eine Halluzination sei so etwas wie ein „Traum im Wachen“. Der Therapeut könne hier vorgehen wie bei der Traumdeutung eines Neurotikers. Wenn der Psychotherapeut mit dem Patienten bedeutungsvoll spreche, so könne er ihn erreichen, schreibt Karon.
Karon sagt, dass es darauf ankomme, mit dem Patienten emotional in Verbindung zu treten. Wenn das gelänge, könne man den psychotischen Patienten genauso frei assoziieren lassen wie den neurotischen Patienten auch. Man könne insbesondere auch in die Tiefe gehen und auch tiefe Deutungen geben. Es komme darauf an, dem Patienten zu zeigen, dass seine Symptome eine Bedeutung haben, dass es da ganz viele Symbole gibt, die sich verstehen lassen. Auch Patienten, die nicht sprechen, seien erreichbar, wenn der Therapeut zu ihm bedeutungsvoll spreche und ihm die inneren Bilder mitteile, die der Patient in ihm hervorruft.
Karon macht auch deutlich, dass die Mutter eindeutig der wichtigere Elternteil des Patienten ist, und dass es bei Schizophrenien vorrangig um die Mutter geht. Es gehe um die Angst vor dem „wichtigeren Elternteil, der Mutter“ („the fear of the more important parent, the mother“, S. 204). Diese Mutter sei als so überwältigend erlebt worden, dass der Patient kaum etwas dagegensetzen oder Eigenes entwickeln konnte. Viele haben die Phantasie, ihr Körper sei der Besitz der Mutter. Wenn die Patienten über Gott halluzinierten, dann sei mit „Gott“ sehr oft die Mutter oder auch der Vater gemeint.
Es gehe vor allem darum, dem Patienten den Unterschied zwischen Denken und Handeln zu verdeutlichen. Karon verdeutlicht den Patienten, dass es völlig in Ordnung, ja natürlich ist, die Mutter zu hassen, die so großes Leid verursachte. Er führt die Patienten dahin, dass sie sich ihre Gedanken erlauben können. Es sei in Ordnung, die Mutter in Gedanken zu töten – sie dürfe zwar nicht in der Realität getötet werden, aber in Gedanken schon. Das sei oft eine neue Erkenntnis für die Patienten und entlaste sie enorm.
Immer wieder gehe es auch um das Thema „Verrat“ („Treason“, S. 205/206). Die Patienten haben eine so große Angst, die Eltern zu „verraten“, dass sie in Rätseln sprechen. Wenn der Psychotherapeut sich bewusst werde, dass der Patient damit seine Eltern schonen möchte und Angst vor dem Verrat hat, dann könne er vorsichtig in diese Richtung deuten. Gerade auch bei sexuellen Problemen der Schizophrenen und psychisch schwer Gestörten gehe es um die Phantasie, einen Elternteil zu verraten, sobald sie mit einem Partner schlafen.
Bei Patienten, die Gewalt androhen, die plötzlich das Messer oder die Pistole zückten, gehe es insbesondere um Angst. Polizisten, Ärzte und Therapeuten sollten sich bewusst sein, dass der Patient, der die Waffe zückt, selbst eine riesige Angst habe. Er fühle sich bedroht. Wenn es gelänge, ruhig zu bleiben, die Angst anzusprechen und zu sagen: „Du hast vor mir nichts zu befürchten“, könne man die Patienten oft erreichen, so Karon.
Wenn es darum geht, Patienten festzuhalten, damit der Psychotherapeut sich nicht um seine eigene körperliche Unversehrtheit sorgen muss, dann sei es besser, den Patienten mithilfe von Menschen festzuhalten als ihn festzubinden. Karons Erfahrung ist, dass auch die hoch akuten psychotischen, also oft wütenden und ängstlichen Anfälle in relativ kurzer Zeit wieder zurückgehen, wenn man mit dem Patienten in bedeutungsvoller Weise spricht und eine emotionale Verbindung anspricht.
Es komme darauf an, dass die umstehenden Ärzte und Therapeuten die Ruhe bewahren und nicht sofort zu Gurten oder Medikamenten greifen. Durch diese panikartige Sofortreaktion käme es dazu, dass die meisten Ärzte und Therapeuten heute glauben, man müsse die Patienten erstmal außer Gefecht setzen.
Karon plädiert auch dafür, psychotischen Patienten eher eine intensive ambulante Psychotherapie anzubieten, als sie ins Krankenhaus aufzunehmen. Nur, wenn der Patient dringend aus seinem Umfeld entfernt werden müsse, sei eine Krankenhausaufnahme sinnvoll.
Karon sagt, dass diese Patienten fünfmal pro Woche mindestens 30-minütige, besser 50-minütige Gespräche erhalten müssten. Mit neuem Denken könne es möglich werden, unsere festen Strukturen aus Medikation und Krankenhausbehandlung aufzubrechen und den Blick auf die ambulante Behandlung zu weiten. Psychisch schwer kranke Menschen bräuchten an allererster Stelle psychisch gesunde Menschen, mit denen sie bedeutungsvolle Gespräche führen könnten, so Karon. Dazu gehöre eine intensive, psychoanalytische Schulung aller im psychiatrischen Bereich tätigen Ärzte, Therapeuten, Schwestern und Pfleger. Denn psychotische Symptome seien zu betrachten wie Träume: Sie haben einen sehr tiefen Sinn und wenn der Therapeut diesen Sinn entschlüsseln und richtig deuten könne, werde der Patient jedes Mal ein kleines Stück geheilt, so Kohen.
dieser beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 10.11.2019
aktualisiert am 26.2.2024
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Hallo ,
interessantes Thema … Oft sind ähnliche Sympthome bei gestressten Leuten zu beobachten.
Gibt es dieses Buch auch in einer deutschen Übersetzung .
Echt gute informative Website hier . Sehr gute Artikel ,lesenswert :)
Vielen Dank
J.B