



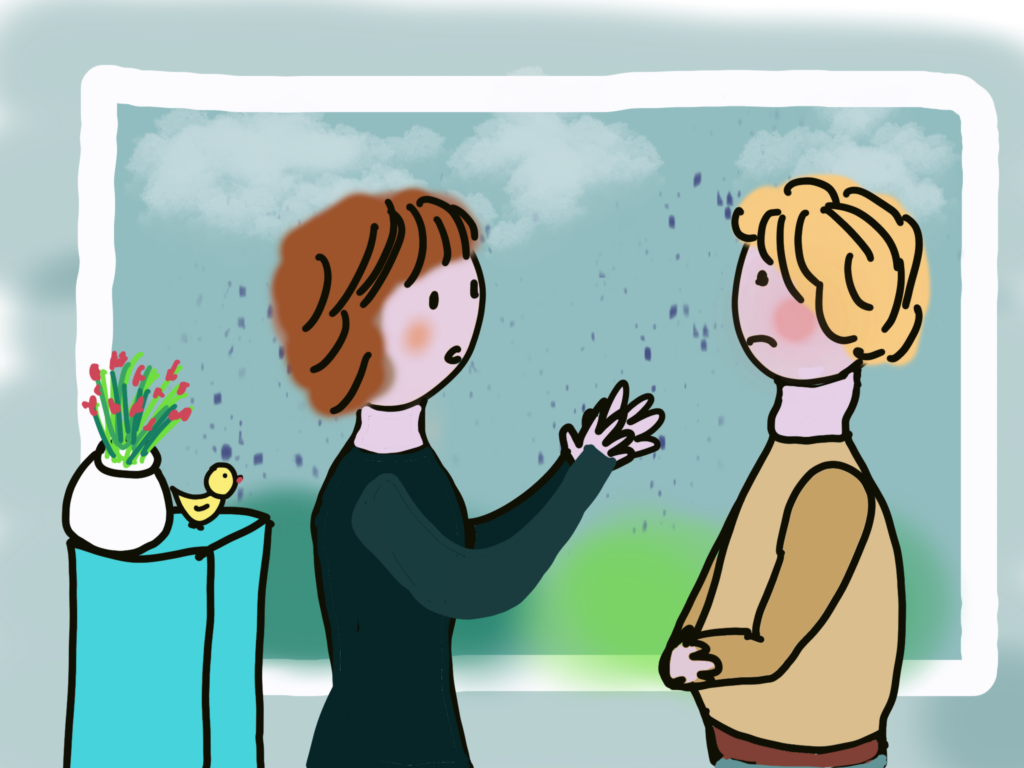
„Wenn ich in einer Beziehung bin, weiß ich nicht mehr, was ich will“, sagen wir. Oft haben wir den Anspruch, stets zu wissen, was wir wollen. Doch das ist oft schwierig, besonders im Zuzweitsein. Je nachdem, wie wir aufwuchsen, fällt es uns zudem sehr schwer, zu äußern, was wir wollen. Vielleicht hatten wir eine verletzliche Mutter, der jede Form der Trennung Angst gemacht hat. Trennung fängt schon da an, wo die Mutter etwas meint und das Kind etwas anderes meint. Wenn wir bemerkten, wie verletzlich die Mutter war, redeten wir ihr nach dem Mund, weil wir spürten, dass wir sie dadurch emotional stabil halten konnten. Wir schauten vielleicht stets nach ihr und versuchten, sie zu lesen. Die Frage „Was kann sie nun wollen?“ wurde zur zentralen Lebensfrage und auf einmal merkten wir: Ich weiß gar nicht mehr, was ich eigentlich selbst will.
Der Ausdruck „falsches Selbst“, geprägt vom Psychanalytiker Donald Winnicott, soll diesen Zustand beschreiben: Ein Kind benimmt sich nur noch, wie die Mutter es will. Es denkt wie sie und spricht wie sie. Obwohl es den Unterschied zur Mutter spürt, versucht es manchmal, sich so zu fühlen, wie die Mutter es erwartet oder wünscht. Sagt die Mutter: „Du brauchst keine Angst zu haben“, dann ist das Kind irritiert, wenn es gerade gar keine Angst hat. Glücklicherweise merkt es irgendwo, dass es nicht stimmt, was die Mutter von ihm glaubt. Und doch versucht es irgendwie, sich an die Aussage der Mutter anzupassen.
Wenn wir mit einer sehr empfindlichen Mutter gross wurden, haben wir unser Leben nach ihr ausgerichtet. Vielleicht richteten wir uns auch immer nach dem Voater – wie auch immer: Ein anderer sagte uns, wo wir lang gehen sollten. Immerhin gelingt es uns vielleicht, wenigstens zu wissen, was wir wollen, wenn wir alleine sind. Kommt ein anderer hinzu, läuft der Anpassungsvorgang. Das ist auch ein bisschen natürlich, denn wir alle passen uns dem anderen ein wenig an und gehen auf ihn zu. Je verletzlicher und empfindlicher der andere erscheint, desto vorsichtiger behandeln wir ihn.
Hinzu kommt, dass sich unser Unbewusstes ebenfalls mit dem anderen verbindet. Unsere „Spiegelneurone“ springen an – wir fühlen uns vielleicht zumindest ein bisschen so, wie der andere sich fühlt. Wir spüren, wie es uns selbst beeinflusst, ob der andere sich gut fühlt oder nicht. Sprechen wir mit einem ausgeglichenen Menschen, fühlen wir uns selbst bald gelassener. Begegnen wir einem angespannten Menschen, geraten auch wir in Spannung. In aufgeheizten Gefühlslagen ist es oft besonders schwer, zu wissen, wer wir eigentlich sind. Glücklicherweise wird es doch leichter, je älter wir werden, denn wir lernen uns wie immer besser kennen, wenn wir uns für uns selbst interessieren.
Fühlen wir Unangnehmes, dann versuchen wir, es los zu werden. Ungeduld, Schuldgefühle oder Wut wehren wir gerne ab. Wir wollen uns etwas Positives einreden und wir bewegen uns unruhig (Freud nannte das „motorische Abfuhr“). Wir versuchen oft auch, durch viel Reden (auch eine Art motorischer Abfuhr) unsere unangenehmen inneren Regungen abzumildern. Dabei haben wir vielleicht auch den Eindruck, dass es auch dem anderen schlechter geht. Auch seine Spiegelneurone sind aktiv. Das nehmen wir als Gelegenheit, dem anderen die Schuld zu geben und dem anderen Ungeduld zu unterstellen – wir projizieren unsere Gefühle auf den anderen. Wir erhoffen uns dadurch Entlastung, aber merken, dass das irgendwie nicht funktioniert. Und wir spüren: Wenn wir projizieren und etwas von uns selbst sozusagen auf den anderen verlagern, dann bleibt noch weniger von uns selbst in uns.
In Psychoanalysen können solche Vorgänge wie unter einer Lupe beobachtet werden. Manchmal wissen weder Analytiker noch Analysand, was sie eigentlich wollen, denken oder fühlen, sodass der Psychoanalytiker Anthony Bass einen wunderbaren Artikel geschrieben hat mit dem Titel: „It takes One to know One. Whose unconscious is it anyway?“ (Psychoanalytic Dialogues, 2001). „Wessen Unbewusstes ist das hier eigentlich?“ ist eine kluge Frage. Wir sehen, wie schwierig es sein kann, bei sich selbst zu bleiben, wenn man zu zweit ist. Manchmal ist es da schon wieder zu dritt oder in einer grösseren Gruppe leichter, weil wir da wieder etwas „freier“ stehen. Solange die Aufmerksamkeit der Gruppe sich nicht auf uns richtet, können wir wie in einer Geschwisterreihe etwas aufatmen, weil wir merken, dass nicht der Blick eines anderen auf uns klebt. Doch wie kann ich „bei mir“ bleiben, wenn ich zu zweit bin? Manche Menschen verlieren sich im Zuzweitsein so sehr, dass sie sehr starke Ängste bekommen. „Immer, wenn ich in eine Partnerschaft gehe, werde ich mit der Zeit psychotisch“, las ich einmal.
Das Gefühl, der andere wüsste es besser oder er wüsste sogar besser, was mir gut tut, entsteht oft, wenn wir so aufgewachsen sind, dass die Mutter meinte, sie wisse immer, was ihr Kind denke oder wie es ihm gehe. Der Weg da raus ist beständiges Üben. Du kannst immer nur wieder üben, in dich selbst zu schauen, vor allem, wenn du alleine bist. Vielleicht leidest du darunter, dass du denkst: „Ausser Verwirrung kann ich da nichts erkennen.“ Doch du kannst darauf vertrauen, dass in dir auch ein Empfinden ist, das irgendwann deutlicher wird und dir wenigstens eine Richtung anzeigt. Bist du dann wieder mit dem anderen zusammen, kkann es sein, dass deine innere Stimme wieder leiser wird und vielleicht kaum noch hörbar ist. Doch du kannst lernen, dich im Zuzweitsein auf dich selbst zu konzentrieren und bei dir zu bleiben. Es ist nicht immer leicht, sich einen inneren Raum zu verschaffen, während man zu zweit ist.
Manchmal erscheint es vergeblich, sich auf sich selbst zu konzentrieren und nachzudenken. Doch wir haben ein inneres Gefühl, das sich meldet. Wir haben einen Bauch. Und in den können wir hineinspüren. Was „sagt“ der Bauch, wie fühlt es sich an, während wir vor dem Partner stehen und sagen: „Ja, stimmt“, oder „Ich möchte das so machen (wie Du willst).“ Stelle dir vor, dass du weisst, was dir schmeckt. Wenn du keinen Rosenkohl magst, dann magst du ihn auch nicht, wenn du mit jemandem am Tisch sitzt, der gerade Rosenkohl geniesst. Der Körper ist oft sicherer als unser Kopf (obwohl der ja auch zum Körper gehört).
Wir können für unser Gefühl im Bauch sensibel werden. Dann wissen wir schon mal ein bisschen, wohin „Es“ uns selbst führen möchte und ob unser Körper damit einverstanden ist, was wir dem anderen gerade gesagt haben. Im zweiten Schritt ist dann die Frage: Finden wir den Mut, zu sagen, was wir „wirklich“ fühlen? Es könnten Schuldgefühle entstehen. Dürfen wir dem anderen zumuten, dass wir etwas wollen oder meinen, was bei ihm auf Widerstand stösst? Schuldgefühle und schlechtes Gewissen sind höchst unangenehme Regungen und doch sind sie es wert, genau gespürt zu werden.
Wir können vielleicht sogar mit dem anderen darüber sprechen. Wir können sagen, dass wir uns nicht gut damit fühlen, jetzt auszusprechen, was der andere so schwer ertragen kann. Wir können vielleicht unser Mitgefühl in uns spüren und dieses Mitgefühl auch in unsere Stimme legen. Vielleicht fällt uns auch selbst schwer, die psychische Trennung zu spüren, die entsteht, wenn wir dem anderen etwas sagen, das uns von ihm unterscheidet. Wir befürchten vielleicht, dass der andere diese innere Trennung nicht „überleben“ könnte, also dass er unerträglich wütend wird.
„Allein bin ich da, zu zweit bin ich weg.“
Vielleicht haben wir sogar Sorge, unsere „innere, psychische Trennung“ könnte eine echte, äussere Trennung nach sich ziehen. „Du wirst schon sehen, was du davon hast“, sagen Eltern manchmal, um zu verhindern, dass ihre Kinder etwas sagen oder tun, was sie von den Eltern trennen könnte. Unsere inneren Sätze, die uns die Eltern mitgegeben haben, erscheinen uns manchmal wie lästige Fliegen oder eiserne Gurte. Es ist ein jahrelanges Ringen, sich von so manchen Sätzen der Eltern innerlich zu befreien. Doch auch in der Zweierbeziehung können wir in uns hineinhorchen, uns spüren und vielleicht sogar wissen, was wir wollen (was wir sowieso oft nicht wissen). Oder wir können wenigstens versuchen, unsere Aufmerksamkeit auch uns selbst zu schenken, nicht nur komplett dem anderen.
Sagen, was wir wirklich denken – manchmal haben wir dazu den Mut und manchmal nicht. Und manchmal wissen wir es eben nicht – vielleicht, weil allein die Anwesenheit des anderen alles in uns vernebelt. Scham und Schuld können sich breit machen, aber die gehören dazu. Wichtig ist die Einsicht, dass wir den anderen in Wirklichkeit meistens viel mehr damit verletzen, wenn wir ihm nach dem Mund reden als wenn wir uns zeigen, „wie wir wirklich sind“ (wobei das oft eine hohe Kunst ist).
Wir passen uns manchmal auch einfach dem an, wovon wir glauben, dass der andere es will oder braucht. Im Grunde passen wir uns oft unserer eigenen Phantasie an. Wir glauben vom anderen etwas, was vielleicht gar nicht zutrifft. Aber wir wollen seine Liebe oder vielleicht auch einfach seine pure Anwesenheit nicht verlieren.
Manchmal haben wir das Gefühl, der andere sei mit unserer Entscheidung nicht einverstanden. Dabei kann es aber sein, dass wir unsere eigenen Zweifel ausgelagert haben. Wir meinen, wir nehmen Zweifel beim anderen wahr, dabei sind es unsere eigenen Zweifel. Auch dieses Wissen kann helfen und man kann sich fragen: „Wo sind meine Zweifel und kann ich sie wahrnehmen und annehmen?“ Und manchmal merken wir, dass wir einen bestimmten Weg gehen wollen und das Gefühl haben, der andere ist damit einverstanden. Das sind oft die schönsten Momente, in denen wir mit uns selbst im Reinen sind – wenn der andere es dann auch noch gutheißt, fühlen wir uns unbeschwert.
Fazit: Es ist in der Tat oft schwer, zu wissen, was man selbst will, wenn man mit einem anderen zusammen ist. Wie wir aufwuchsen, wie der andere aufwuchs, wie empfindlich der andere ist und wie die Umstände sind – das alles spielt mit in die Beziehung hinein. Sich selbst oder den anderen für seine „Anpassung“ zu verurteilen, bringt erneute Scham- und Schuldgefühle, aber auch Wut, weil man ja eben alles getan hat, um dem anderen zu gefallen. Hier können wir immer und immer wieder genau in uns hineinfühlen und darüber nachdenken, was da vor sich geht und Stück für Stück weiterkommen – immer in dem Wissen, dass es das tiefe Bedürfnis des Menschen ist, sich mit anderen zu verbinden. Und wenn wir gar nicht wissen, was wir wollen, können wir uns vielleicht mit dem Religionsphilosophen Allan Watts verbinden, der in einem seiner Vorträge sagte: „Dieses ‚Ich weiß nicht‘ ist dasselbe wie ‚Ich liebe‘.“ (Youtube: Just trust the universe und Why you don’t know what you want, ab Minute 1:40)
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 16.10.2018
Aktualisisert am 17.6.2025
VG-Wort Zählpixel 12fefab50ece43c580dde7b58aece923