



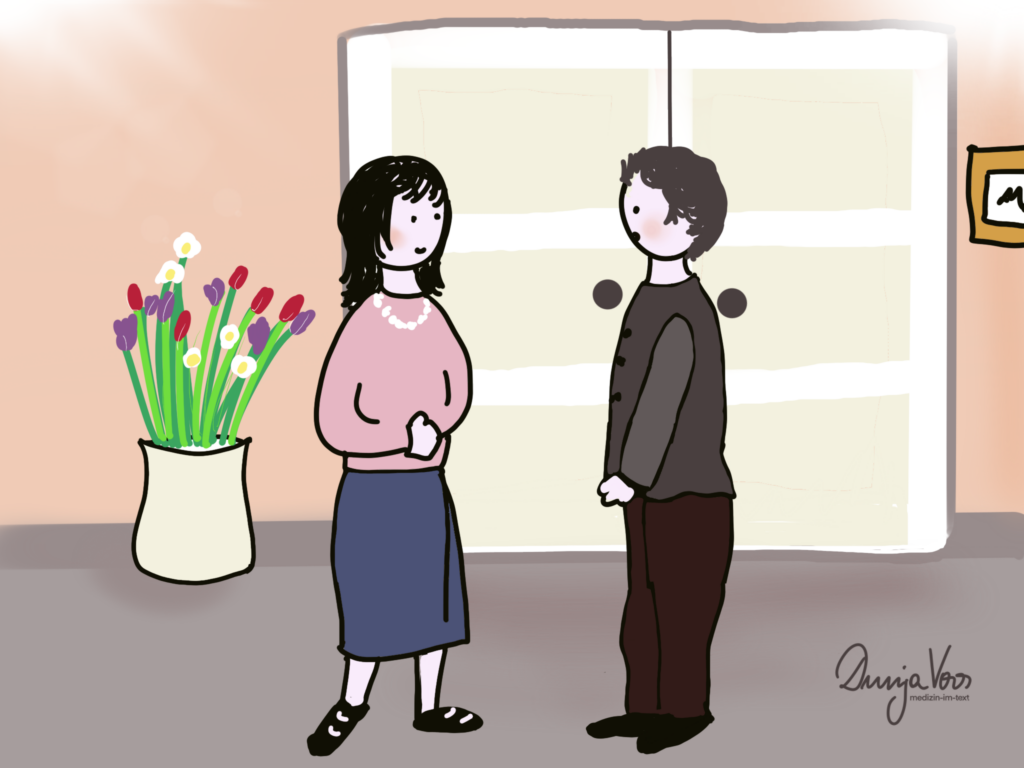
„Da musstest Du ja sicher viel lesen und Theorien lernen“, hörte ich manchmal, wenn ich sagte, dass ich eine Ausbildung zur Psychoanalytikerin bei der Deutschen Psychoanalytischen Vereinigung (DPV) gemacht (aber nicht abgeschlossen) habe. Doch diese Ausbildung ist anders als ein Medizin- oder anderes verkopftes Studium. Besonders in Prüfungen – sei es im Vorkolloquium, im Zentralseminar oder im Kolloquium – wird das deutlich. Worauf es in einer Psychoanalyse-Prüfung ankommt, zeigt aus meiner Sicht die wunderbare arte-Dokumentation „Dirigenten – jede Bewegung zählt“. Sie erzählt die Geschichte eines jungen Dirigenten, der an einem Wettbewerb teilnimmt und weit hinten landet, obwohl er über Talent, Musikalität, Technik, Wissen und Können verfügt. Er solle es noch einmal in zwei Jahren versuchen, wird ihm gesagt.
In der Psychoanalyse-Prüfung stellt Ausbildungskandidat einen seiner Ausbildungsfälle in anonymer Form vor. Er referiert über die Analyse, wobei das Erstinterview, das szenische Verstehen, die Beziehung (Übertragungen, Gegenübertragungen), Gefühle, Bedeutungen und Träume besonders wichtig sind.
Der Grund für das „Nicht-Bestehen“ dieses Dirigenten wird im Film nicht genau benannt, doch beim Zuschauen wird deutlich: Er ist zu streng, er nimmt keinen zugewandten Kontakt mit den Orchestermitgliedern auf, die Orchestermitglieder wenden sich ab und tuscheln miteinander. In seinem Gesicht steht Angst. Vielleicht ist eine schwierige Kindheit der Grund für seine jetzige Suche nach Anerkennung. Er wirkt innerlich gehetzt, verlassen und verzweifelt und überträgt das auf die Orchestermitglieder. Er kann nichts von ihnen aufnehmen, nichts verdauen.
Wenn man fragt: „Worauf kommt es in der Psychoanalyse-Prüfung (Beispiel DPV) an?“, könnte man auch fragen: „Worauf kommt es in einer Partnerschaft an? Worauf bei einer Kontaktaufnahme, in der Beziehung zum Kind, zu Freunden, zu Eltern, zu Vorgesetzten und Kollegen?“ Es kommt vielleicht darauf an, dass man als Prüfling selbst ausreichend gute Erfahrungen in haltgebenden Beziehungen gemacht hat, sodass es möglich wird, die Dinge – angenehme wie unangenehme – zuzulassen, anstatt sie abzuwehren. In der Prüfung zeigt sich, ob es dem Kandidaten/der Kandidatin gelingt, der Prüfungsgruppe ausreichend vertrauensvoll zu begegnen und in einen Austausch zu kommen. So können die Püfer*innen davon ausgehen, dass der Kandidat/die Kandidatin auch zu seinen/ihren Patienten einen solchen Kontakt herstellen kann.
Im End-of-Training-Evaluation-Project der European Psychoanalytical Federation (EPF, www.epf-fep.eu) werden die Ziele der psychoanalytischen Ausbildung so beschrieben (aus dem Englischen frei übersetzt von Voos):
Quelle: Eike Hinze: What do we learn in psychoanalytic training?
Im Beitrag „Problems of Psychoanalytic Training“ schreibt der Psychoanalytiker Maxwell Gittelson (1902-1965, In Memoriam), was Helene Deutsch (1941) über die Anforderungen der Psychoanalyse sagte: „An intuitive understanding of unconscious processes cannot be learned . A person who does not have this gift cannot become a good analyst.“ (übersetzt von Voos:) „Ein intuitives Verstehen des unbewussten Prozesses kann nicht gelernt werden. Jemand, der dieses Geschenk nicht hat, kann kein guter Psychoanalytiker werden.“
Dabei ist zu bedenken, dass der Text von 1941 ist. Damals dachten viele Psychoanalytiker auch, dass man Psychotiker nicht behandeln könnte, weil sie in keinen Übertragungs-Gegenübertragungs-Prozess kommen könnten. Heute sieht man das anders. Die Psychoanalytikerin Hannah Segal sagt im Video „Encounters through Generations“ (Youtube), dass Intuition auch auf Erfahrung beruht. Ausbildungskandidaten machen eine intensive Lehranalyse, in der sie auch lernen, Unbewusstes zu dekodieren und ein Gespür dafür zu bekommen. Im Geigenunterricht sagte mir ein Lehrer mal: „Das musst Du trauriger spielen.“ Aber es gelang mit nicht.
Erst später lernte ich, dass man zunächst eine gute Geigentechnik erwerben muss, um das Gefühl der Traurigkeit überhaupt technisch umsetzen zu können. Dazu gehört beispielsweise, dass der Bogen fest mit der Saite verbunden bleibt und nicht zittert – diese Technik muss und kann man mithilfe eines guten Lehrers lernen und üben. Und doch gibt es auch natürliche Begrenzungen: Wer die Aufnahmeprüfung an einer guten Musikhochschule bestehen will und trotz allen Übens z.B. bei Repetitionsbewegungen Probleme hat, dem bleibt nichts anderes, als seine „Behinderung“ zu akzeptieren und nach einer Hochschule mit niedrigeren Standards zu suchen.
Meiner Erfahrung nach spielt wohlmöglich auch die eigene Herkunft eine Rolle: Wohl die meisten Ausbildungskandidaten bei der DPV haben mindestens einen Elternteil, der Akademiker ist. Das heißt, die meisten Kandidaten wuchsen bei Eltern auf, die ein gewisses Maß an psychischer struktureller Organisation hatten. Kindern, denen das fehlt und die aus bildungsfernen Haushalten kommen, haben oft eine andere Weise zu denken. Beispielsweise ist das „Eindeutigkeitsmuster“ typisch, bei dem der Betroffene nach eindeutigen und konkreten Antworten sucht – doch in der Analyse muss man aus vielen Richtungen denken und Unsicherheiten ertragen können. Das kann man lernen, aber es braucht viel Zeit.
Zusammenhänge wie diese erklärt der Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani in seinem Video „Womit Bildungsaufsteiger kämpfen“ (Youtube) sehr eindrücklich.
Häufig ist die Affektregulation bei Menschen, die in bildungsfernen Schichten aufwuchsen, relativ schwach – Angst, Wut, Verwirrung und Schuldgefühle sind oft groß. Dann ist es schwierig, intuitiv zu sein und zu bleiben, besonders, wenn Spannungen auftreten. Der Ausbildungskandidat lernt jedoch in der Lehranalyse, in ruhigeres emotionales Fahrwasser zu kommen, sodass Dinge wie Intuition oder eine träumerische Haltung langsam mehr Raum einnehmen können.
Bei der DPV-Ausbildung verhält es sich vielleicht auch ähnlich wie bei einer Promotion: Eine Doktorarbeit zu schreiben und abzuschließen, ist nicht unbedingt Zeichen großen Wissens, sondern insbesondere Zeichen einer ausreichend guten Kommunikationsfähigkeit – denn die Schwierigkeit der Promotion liegt oft in der Kommunikation mit dem Betreuer der Arbeit, mit der Doktormutter/dem Doktorvater, den Studienteilnehmer*innen und dem Studienteam. Letzten Endes muss der Doktorand sich auch innerlich die „Erlaubnis“ geben, die Promotion zu schaffen. Auch hier haben es Menschen aus bildungsschwächeren Elternhäusern schwerer, denn es fühlt sich für sie so an, als ob sie sich zwischen der Loyalität zur Herkunftsfamilie und dem Aufstieg in eine höhere soziale Schicht entscheiden müssten.
„Du musst lernen, zu spüren, wann Du loslassen kannst, wann das Orchester von selbst läuft und wann Du wieder eingreifen musst“, sagt ein Orchestermusiker zu dem Dirigenten-Prüfling.
In der Psychoanalyse-Prüfung (Beispiel DPV) kommt es auf die Beziehungsgestaltung an. Dazu gehört auch, sich in den Jahren vor der Prüfung mit den Psychoanalytikern und Kollegen des Instituts vertraut zu machen und die Beziehungen zu pflegen. Es ist gut, wenn man einen guten „sozialen Paten“ oder Mentor findet. Hat man am Ende der Ausbildung die Fähigkeit, sich selbst gut zu beobachten? Kann man sich relativ vertrauensvoll dem hingeben, was da ist, auch wenn es irritierend, bedrängend, beängstigend oder lähmend erscheint? Ist man fähig, von anderen zu lernen und sich in einem guten Sinne zu untergeben und Ordnungen einzuhalten?
„Wenn ich im Medizinstudium in eine Orthopädieprüfung gehe, dann bestehe ich die Prüfung, wenn ich mein Zeugs gelernt habe und es wiedergeben kann.“ In einer Psychoanalyse-Prüfung (Beispiel DPV) funktioniert so etwas nicht. Hier geht es darum, sich zu zeigen und mit der Prüfungsgruppe in Kontakt zu treten.
Die Psychoanalyse selbst besteht aus höchst unguten Momenten. Manchmal tauchen fast unaushaltbare Gefühle auf. Es gibt Angst vor Verwirrung, vor unbewussten Kräften, vor negativen Übertragungen und vor Schuld- und Schamgefühlen. Wichtig ist es, eben auch dieses Negative in der Prüfung darstellen zu können, darüber nachdenken und es weiterentwickeln zu können. Ist die Scham zu groß, kann auch das schwierig werden. Auch die Fähigkeit, zu spielen und zu träumen ist wichtig. Es kommt darauf an, darum zu ringen, zu verstehen, was in der Beziehung zum Patienten passiert und davon zu erzählen. Auch hier gehört es zur Persönlichkeitsentwicklung, dass man zunehmend das, was man selbst meint und entwickelt hat, ernst und wichtig nehmen kann. Wer schon als Kind vor der Familie und vor Erwachsenen sprechen durfte, hat es da leichter als Kinder, die wenig ernstgenommen wurden, wenn sie etwas zu erzählen hatten.
Ist die Angst groß, wird oft auch die Abwehr groß, bevor man die Kunst des Nichtreagierens erlernt hat. Im „alten Film“ werden die anderen zu Monstern, zu Angreifern oder sie werden abgewertet. Man zieht sich zurück und fühlt sich unverstanden. Angst gehört zur Psychoanalyse. Übermächtige Gefühle der Angst, Wut und Schuld sind oft schwer zu handhaben. Es erfordert viel Erfahrung, um sie zur Entwicklung nutzen zu können.
„Du musst einfach selbstbewusst auftreten“, riet mir eine Freundin vor meiner ersten wichtigen Psychoanalyse-Prüfung, vor der ich sehr aufgeregt war und die ich nicht bestand. „Du brauchst eine Strategie“, hörte ich. Und eben darauf kommt es in der Psychoanalyse-Prüfung nicht an. Genau diese Bemühungen sind vollkommen hinderlich, weil sie die Wahrheit verstecken wollen. Es kommt darauf an, das Gegebene fein wahrzunehmen und darauf flexibel zu reagieren und in Kontakt mit sich selbst und den anderen zu bleiben.
„Es kommt mir ein bisschen vor, als müsste man in der Psychoanalyse-Prüfung zeigen, wie man sein Kind stillt, wenn man seinen Fall vorstellt. Und dann sitzen da die ganzen Erfahrenen, die (Schwieger-)Mütter und Großeltern und Tanten und beurteilen, ob man es denn richtig macht.“ So eine Prüfung eignet sich auch herrlich zur Analyse der eigenen Familien-Übertragung. Die prüfenden Zuhörer und das gesamte Institut nehmen mitunter die Gestalt der eigenen Familie an.
Psychoanalyse-Prüfungen bei der DPV (Zentralseminare, Kolloquien) finden vor einer Gruppe statt. Dort sitzen (Lehr-)Analytiker*innen und Ausbildungskandidaten/-kandidatinnen. Die Zuhörer kommen mit dem Prüfling ins Gespräch. Wie der Prüfling dies empfindet und wie er darauf reagiert, zeigt viel von dem, wie er ist, was er erlebt und überlebt hat, wie er aufgewachsen sein mag, wie er Beziehungen gestaltet, welche Übertragungen er/sie hat und wie gut er/sie sich selbst kennt. In der Gruppe zeigt sich viel von dem, was sich zwischen Patient*in und Ausbildungskandidat*in abspielt. Wenn die Triangulierung mit der (Prüfungs-)Gruppe schwierig ist, kann dies auch Hinweise auf die Behandlungssituation zwischen Ausbildungskandidat und Patient geben.
Die Gruppe kann an den äußersten Enden empfunden werden wie ein mütterlicher Schoß oder wie eine Bataillon von Angreifern. Sie kann auch einschüchternd wirken, denn die Psychoanalytiker, die dort in der Prüfung sitzen, haben selbst eine lange, mühevolle Schule durchlaufen. Als der Bundespräsident a.D. Joachim Gauck 2019 eine Rede bei der DPV-Herbsttagung in Bad Homburg (zum Video) hielt, sagte er am Ende: „Diese Fülle von Intelligenz und Energie in dem Raum, die macht mir wirklich Angst“ (1:06:52).
„Aber so eine Prüfung ist doch nicht objektiv! Da braucht es doch Standards, Leitlinien und Orientierungspunkte, sonst wird doch völlig nach Gusto entschieden!“, höre ich manchmal. Ja, es ist schwierig. Der Gedanke an Willkür taucht mitunter auf. In der Psychoanalyse geht es um Unbewusstes, um Erfahrung, Beziehung, Affekte, Atmosphäre und Persönlichkeit. Und um Kunst. Wie will man das bewerten? Ich habe in meinen Ausbildungsjahren den Eindruck gewonnen, dass so eine Prüfung trotz fehlender „objektiver“ Kriterien zu großen Teilen verlässlich ist. Es ist wie mit dem Dirigenten aus dem Film: Würde man ihn vor ein oder zwei andere Orchester stellen, würden die Mitglieder wahrscheinlich wieder ähnlich reagieren. Das Orchester entfernt sich vom Dirigenten, es ist eher ein unangenehmer Kampf als ein entwicklungsförderndes Miteinander.
Es geht bei der Ausbildung auch um Gruppenprozesse – das Unbewusste macht vor einer Prüfung nicht Halt. Die Deutsche Psychoanalytische Vereinigung (DPV) ist ein Verein. Und Vereinsmitglieder schauen eben auch danach, ob der oder die Neue in die Gruppenstruktur passt. Wer eine Ausbildung bei der DPV macht, muss diesen Punkt berücksichtigen und sich auch selbst befragen: Passe ich in diese Strukturen? Möchte ich zu dem Verein gehören? Welche Gefühle habe ich? Wo rebelliere ich, wo ordne ich mich unter und wo kann ich mich frei bewegen?
„Was man liebt, geht einem an die Nerven“, sagt eine Tierärztin.
Wenn wir uns an die Schule erinnern, dann kennen wir das: Manche Lehrer stehen vor vielen Klassen und es gelingt ihnen immer wieder, Wissen in guter Weise zu vermitteln. Und dann gibt es Lehrer, die die Schulklassen über Jahrzehnte verzweifeln lassen. Auch hier gibt es keine objektiven Kriterien. Es geht um das Menschliche, das sich oft so schwer beschreiben, aber dennoch gut erfassen lässt. Das Messinstrument sind die eigenen Eindrücke und Gefühle. Letzten Endes kommt es immer wieder auf das Menschliche, das Vertrauenswürdige und die Beziehungsfähigkeit an. Ein Hochleistungssportler, der alles gibt, kann am Erfolg zerbrechen, wenn er keine nahe Beziehung zu anderen Menschen hat.
Egal, in welchem Bereich man sich umschaut: „Erfolg“ haben diejenigen, die in guten Bindungen sind.
Am Ende des Dirigenten-Films geht ein warmherziger Kollege auf den erfolglosen Prüfling zu – freundlich und offenherzig sagt er: „Ich habe mich sehr gefreut, Dich kennenzulernen. Lass uns in Kontakt bleiben.“ Er umarmt ihn herzlich. Auch er war nicht unter den Erfolgreichen, doch er hatte „Good Vibrations“, die ansteckend waren. Die Umarmung war sehr berührend und der Film endet damit, dass der gescheiterte Prüfling neue Kraft schöpft. Beziehung ist eben alles.
Eike Hinze:
What do we learn in psychoanalytic training?
The International Journal of Psychoanalysis 2015, Vol. 96, Issue 3: 755-771
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1111/1745-8315.12358
Maxwell Gittelson (1948):
Problems of Psychoanalytic Training
The Psychoanalytic Quarterly, 17:2, 198-211
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21674086.1948.11925719
DOI: 10.1080/21674086.1948.11925719
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 21.7.2019
Aktualisiert am 23.11.2023
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Die erwähnte arte-Dokumentation (nur noch 5 Tage, bis zum 29.7.2019 zu sehen!!) lässt einen den Unterschied zwischen einer Wahrnehmung auf der Basis von ERLERNTEM „KOPF-WISSEN“ und der tieferen, ganzheitlichen Einschätzungskompetenz erfahrener Psychotherapeuten wirklich wunderbar verstehen/erspüren.
Ich habe mich tlw. in dem jungen Dirigenten wiedererkannt, was mich traurig gemacht hat. Bei meiner Erinnerung an Situationen (z. B. bei einer kleinen Ansprache auf einer Weihnachtsfeier), in denen ich so…..angestrengt (nur bei mir seiend und den Worten, die ich bei der Vorbereitung auswendig gelernt hatte) gesprochen hatte, erkenne ich nachträglich auch, dass die Zuhörer (in dem Film die Orchestermitglieder) NICHT so REAGIERT haben, wie ich es bzw. der junge Dirigent es gewüscht/gebraucht hätte. Das macht mich erst recht traurig.
Ein lieben Sommergruss!
Melande