



Das Paar will ins Konzert und die Frau bekommt Migräne. „Vielleicht haben Sie die Migräne ja bekommen, weil Sie wütend waren auf Ihren Mann. So konnten Sie ihm das Leben vermiesen, ohne selbst schuld zu sein.“ Eine Zeitlang war es modern in der Psychoanalyse, das Augenmerk auf mögliche Aggressionen zu legen. Das kann manchmal stimmen und auch hilfreich sein, wenn man denn so wieder die Kontrolle über die Kopfschmerzen gewinnen könnte. Heute prüfen viele Psychoanalytiker jedoch auch, ob nicht ein Trauma hinter der plötzlichen Migräne stecken könnte. Der Konzertsaal kann mit Einengung und Zwang verbunden werden. Schließlich gibt es auch noch die Möglichkeit, dass der Körper aufgrund von Müdigkeit, Unverträglichkeiten und Mangelerscheinungen oder „einfach so“ und weitgehend autonom eine Migräne entwickelt. Weiterlesen
„Der ist ganz schön verstrahlt“, sagen wir, wenn wir jemanden für verrückt erklären. Radioaktive Strahlung ist nicht sichtbar, aber sie kann tödlich sein. Mit der Röntgenstrahlung können wir durch jemanden hindurch schauen und ihn von innen sehen. Nicht selten haben Menschen mit Psychosen schon in der frühen Kindheit körperliche Grenzüberschreitungen wie z.B. sexuellen Missbrauch erlebt. Manche Mütter sagten zu ihrem Kind: „Du bist für mich wie aus Glas“ oder „Der liebe Gott sieht alles.“ So fühlte sich das Kind vielleicht, als sei es ohne Grenze. Weiterlesen
Wenn wir schwer traumatisiert sind, dann wollen wir bei unseren eigenen Kindern alles richtig machen. Spüren wir Aggression gegen unsere eigenen Kinder oder befürchten wir, etwas könnte nicht mit ihnen in Ordnung sein, versetzt uns das in Spannung. Vielleicht reagieren wir diese Spannung am eigenen Körper aus. Vielleicht aber beginnen wir unsere Kinder in einer Art zu „therapieren“, die einer Qual gleichkommt. Ohne es zu wollen, quälen wir unser Kind vielleicht mit der Vojtatherapie, um das Ziel der Gesundheit und Normalität zu erreichen. Die Vojta-Therapie ist eine Form der Krankengymnastik, die häufig bei Babys mit motorischen Entwicklungsstörungen angewendet wird. Hier muss die Mutter das Baby in einer Zwangsposition festhalten und dann gesunde Reflexe beim Baby hervorrufen. Weiterlesen
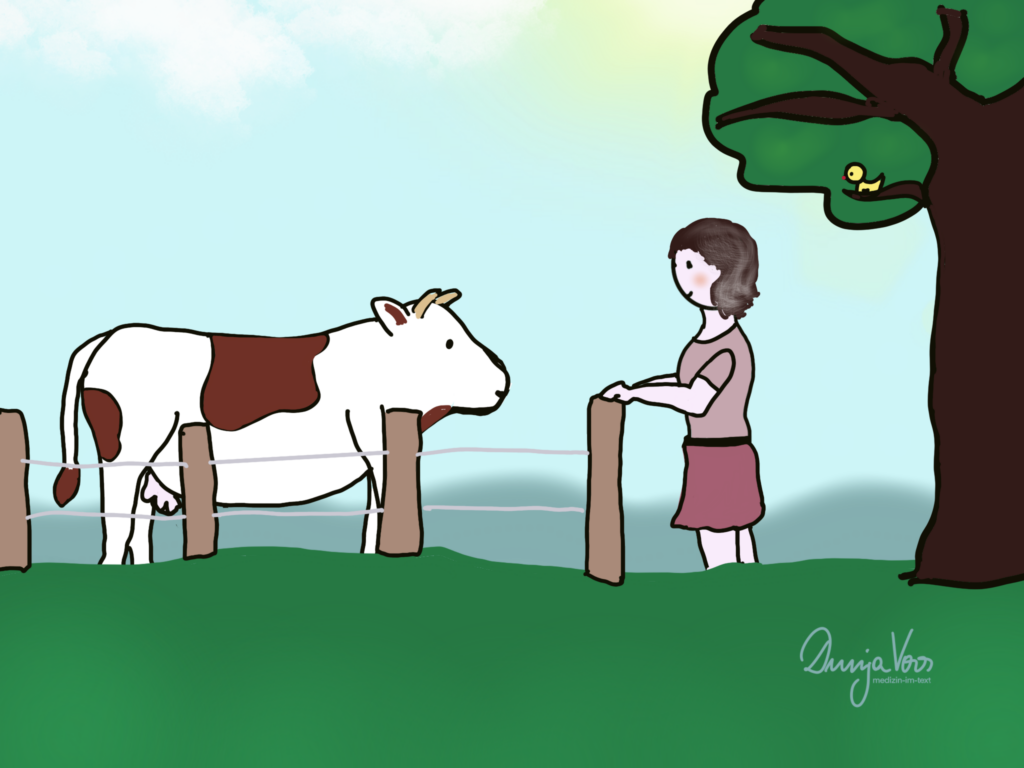
Dieser Zwang zu zerstören entsteht nur aus Angst. „Nie wieder“ lautet das Ziel. Immer. Das Kind, es kann nur erahnen, wann der nächste Angriff kommt. Sein Schreien klingt wie eine Melodie. Erst zaghaft, fragend, klagend. Können die das wirklich wieder tun? Diesmal wird’s doch nicht so schlimm – oder? Doch, auch diesmal wird’s schlimm. Und erbarmungslos. Die Sprache, es gibt sie noch nicht. Kein Wort. Das Schreien steht auf. Das Kind, es schreit in Not. Alle hören es. Doch keiner hört hin. Keiner geht hin. Die Täter und Täterinnen machen weiter. Spitze, verzweifelte Schreie. Das hört niemals auf. Weiterlesen

Manchmal stellen wir unsere Borsten auf, sobald uns jemand mit Zärtlichkeit begegnet. Wenn wir nur wenig Zärtlichkeit in unserem Leben erfahren, wächst die Sehnsucht danach. Wenn uns dann jemand zärtlich begegnet, spüren wir nochmal sehr deutlich, was wir alles vermisst haben. Der „Schmerz des Unterschieds“ zwischen der Zärtlichkeit jetzt und dem Mangel, der ansonsten herrscht, ist nur schwer auszuhalten. Zudem kann die gefühlte oder phantasierte Nähe zur Sexualität oft Scham hervorrufen – besonders, wenn die Zärtlichkeit unpassend ist. Weiterlesen
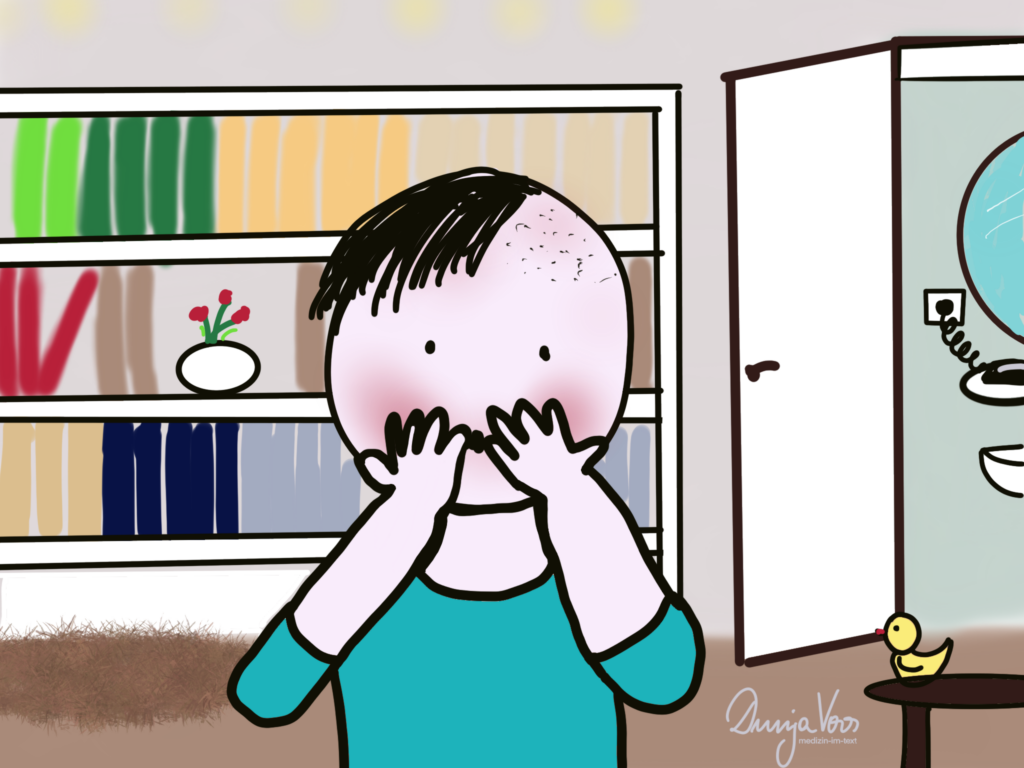
„Der liebe Gott sieht alles“, sagen manche Eltern. Oder sie sagen: „Der Weihnachtsmann weiß, wann du böse warst.“ Ich glaube das nicht. Ich glaube, dass jedes Kind und jeder Erwachsene eine Schutzhülle hat und braucht, damit es ihm gut geht. Auch unser Herz liegt geschützt in unserer Brust und ist für andere nicht sichtbar. Nur so können wir gesund bleiben. Jedes Kind und jeder Erwachsene braucht einen Raum, wo er ganz allein für sich sein kann. „Das ist privat“ nennen es die Erwachsenen, wenn sie sagen wollen, dass es andere nichts angeht, was sie tun oder denken. Weiterlesen
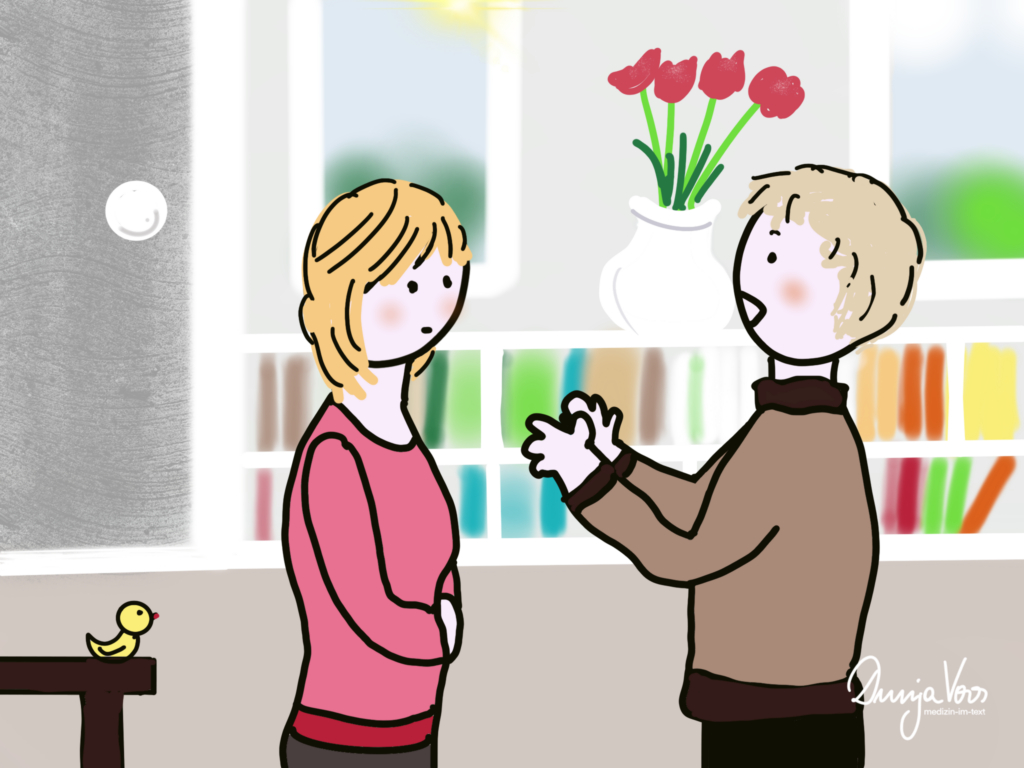
„Der Druck kommt immer dann, wenn ich vor einer Verpflichtung stehe oder wenn ich in eine Situation komme, in der etwas Bestimmtes von mir erwartet wird – und sei es nur, während eines Gespräches nicht aufs Klo gehen zu dürfen. Der Stuhldrang taucht unaufhaltsam in mir auf.“ Vielleicht kennst du das. Die Durchfälle schränken das Alltagsleben stark ein. Vielleicht hattest Du schon beim Aufwachen dieses Rumor-Gefühl. Wie soll man erklären, dass man schnell weg muss? Das Reizdarmsyndrom ist eine Qual – und hängt eng mit engen Beziehungen zusammen. Weiterlesen