



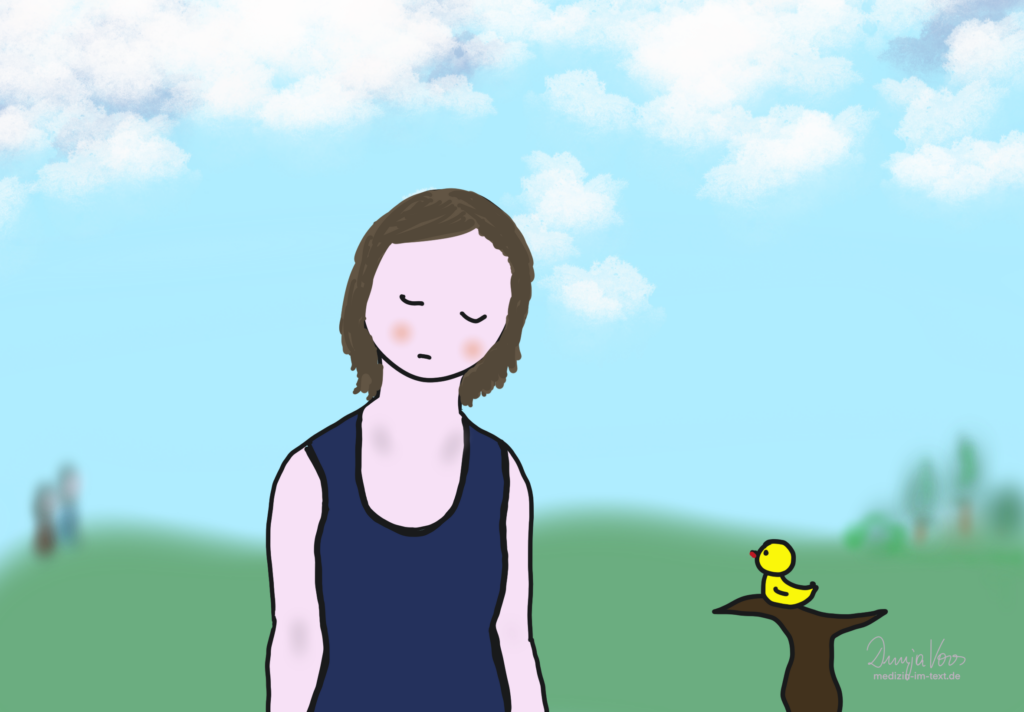
Keine Geschwister. Schwister. Wister. Keine Eltern. ltern. milie. Unfassbar. einsam. gemeinsam. die anderen. nderen. nur. die. Weiterlesen
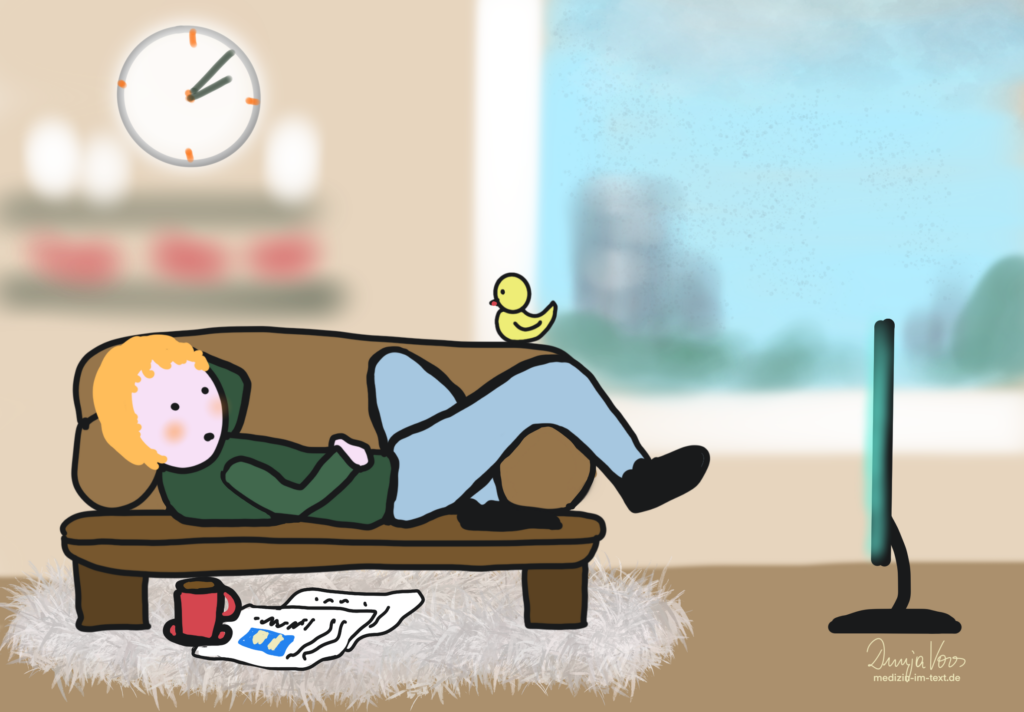
„Früher bin ich auch alleine schwimmen gegangen, aber jetzt mache ich das nicht mehr. Wenn ich alleine raus gehe, dann fühle ich mich noch einsamer. Wenn ich zu Hause bleibe, muss ich wenigstens nicht die anderen glücklichen Menschen, die Pärchen und Familien sehen.“ Vielleicht geht es Dir ähnlich. „Geh`doch mal raus“, raten die anderen Dir. Und Du denkst: „Wenn ich solche Aufförderungen schon höre, krieg‘ ich die Krise.“ Rausgehen ist manchmal das Letzte, was die einsame Seele braucht. Du spürst vielleicht: Der Rückzug auf Dich selbst kann die Einsamkeit paradoxerweise oft wenigstens etwas lindern – jedenfalls im Vergleich zu dem Gefühl, das aufkommt, wenn Du „raus gehst“.Weiterlesen
Da ist eine Perle in mir. Ich bin eine Auster und lasse mich in der Tiefe des Meeres sanft hin- und herbewegen. Meistens ist meine Schale zu, denn ich befürchte, dass man mir meine Perle klauen könnte, wenn ich mich öffne. Was aber, wenn es gar nicht (mehr) so ist? Was, wenn die anderen respektvoll vor mir stehen bleiben? Wenn sie mein Gesicht, meine Perle respektieren? Wenn sie selbst darum bemüht sind, meine Perle zu beschützen? Ich komme an einer anderen Auster vorbei. Sie ist weit offen und trägt eine wunderschöne Perle. Ich sehe sie glänzen. Neid kommt auf. Und auf einmal bin ich es, der rauben will! Ich will diese Perle haben, ich will sie klauen, mir zu eigen machen. Doch dann fällt mir meine eigene Perle ein. Ich hätte nichts davon, die andere Perle zu klauen. Sie würde nicht zu mir passen. Ich hinterließe eine leere Schale und würde selbst einsam werden. Da ist es doch sinnvoller, ich lasse meine eigene Perle in Ruhe wachsen, sodass sie selbst schön glänzt.Weiterlesen
Als ich damals mit meiner Psychotherapiepraxis begann, brachten irgendwann die ersten Mütter ihr Baby oder Kleinkind mit zur Sitzung, wenn sie keine Betreuung fanden oder das Kind noch sehr klein war. Zuerst saßen wir auf unseren Stühlen, während das Kind herumkrabbelte oder an Mamas Bein hing. Es war nur natürlich, dass sich die Mütter bald auf den Boden neben das Kind setzten und von dort aus weitererzählten. Mich hat dabei sehr berührt, wie schnell sie Vertrauen fassten und in dieser Position die Psychotherapie nutzen konnten.Weiterlesen
Die Psychoanalytikerin Clara Mucci publicseminar.org beschreibt, wie sie in der psychoanalytischen Ausbildung nicht genügend Handwerkszeug fand, um komplex traumatisierten Menschen zu helfen. Sie beschreibt, dass es sich bei den unerträglichen Zuständen der Betroffenen um eine Art „Erinnerung“ (siehe implizites Gedächtnis) an das handeln könnte, was die Betroffenen in frühester Kindheit erfahren haben. Weiterlesen
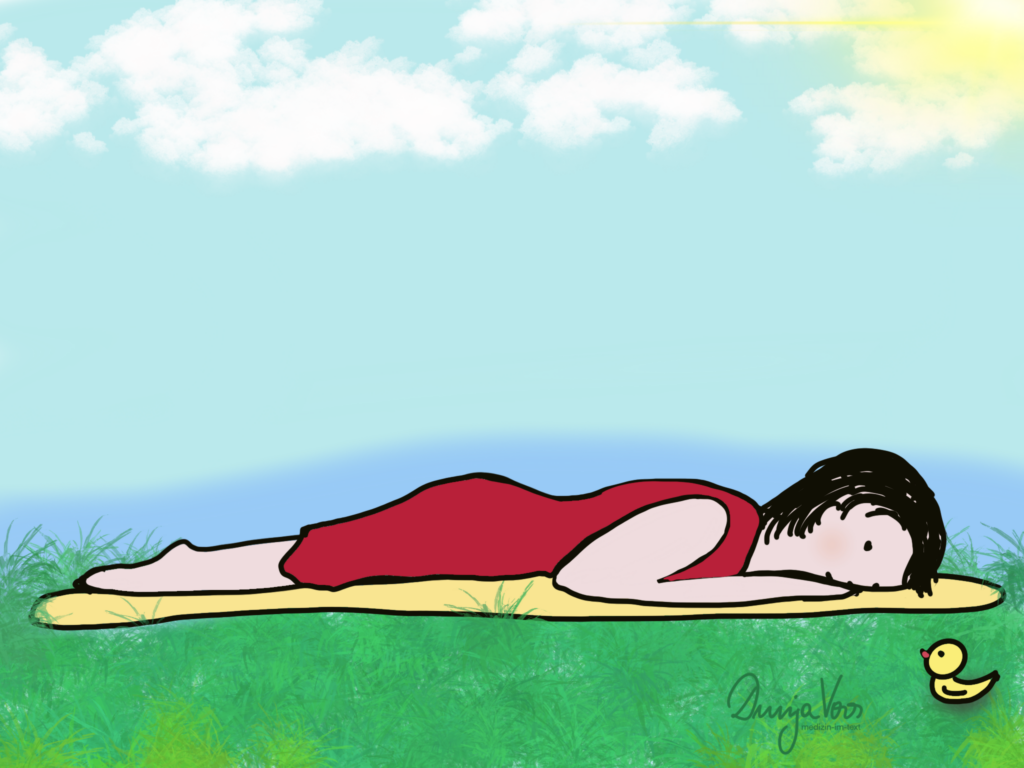
Vielleicht hast Du das Gefühl, dass Du Dich so gut wie nie geborgen fühlst. Das grundlegende Geborgenheitsgefühl entsteht besonders in den ersten Lebensmonaten. Die Mutter ist wohl der bedeutsamste Mensch in unserem Leben, denn die ersten Lebensmonate verbrachten wir in ihrem Körper. Wenn wir schon früh von der eigenen Mutter traumatisiert wurden, wurden wir vielleicht real körperlich beschädigt. Du hast vielleicht auch das Gefühl, dass ein Teil Deiner Seele zerstört wurde. Wie dies ungewollt passieren kann, zeigt z.B. die Säuglingsforscherin Beatrice Beebe in ihrem Video (Youtube, ab Minute 27). Weiterlesen
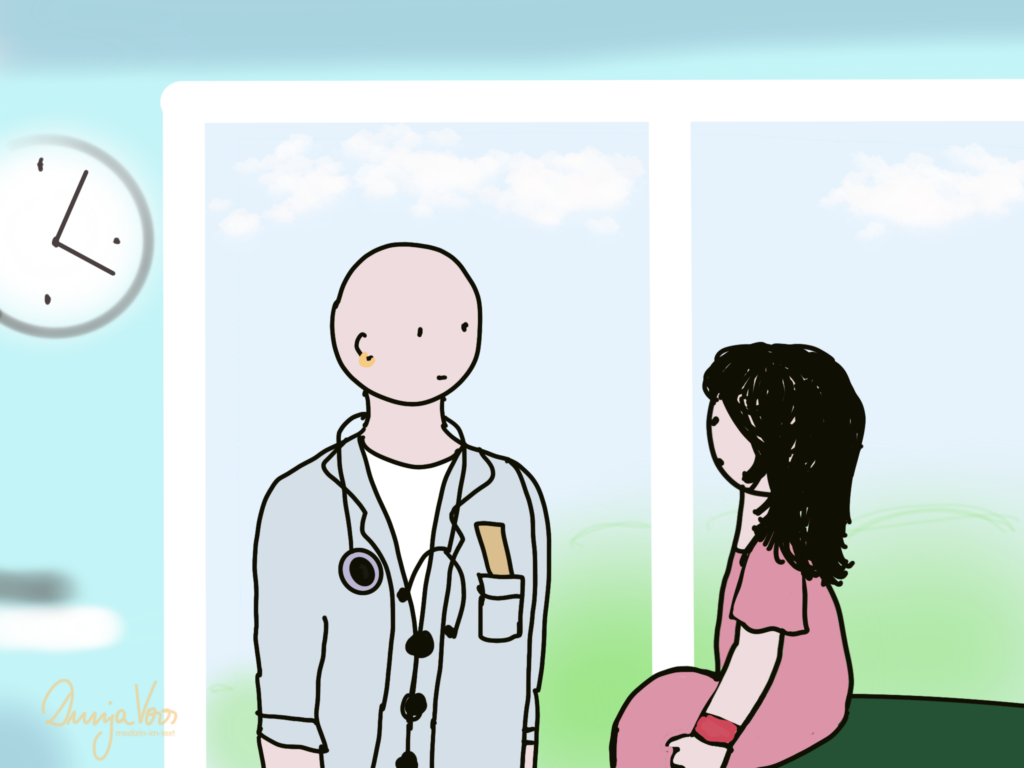
in der vojtatherapie wurdest du als baby und kleinkind „behandelt“. das kann dazu führen, dass du grundsätzlich „behandlungen“ als traumatisierend erlebst. der „behandler“ erinnert dich möglicherweise an deine mutter oder die physiotherapeutin, die dich mit vojta „behandelten“. das kann mit ein grund sein, warum du vor behandlungen jeglicher art möglicherweise mit durchfall oder anderen vegetativen symptomen reagierst. auch der psychotherapeut ist ein behandler. daher kann auch eine psychotherapie für dich beängstigend sein. übung: beziehe die sprache in deine überlegungen mit ein. wie fühlst du dich, wenn du zu einem therapeuten = „behandler“ gehst? Weiterlesen