



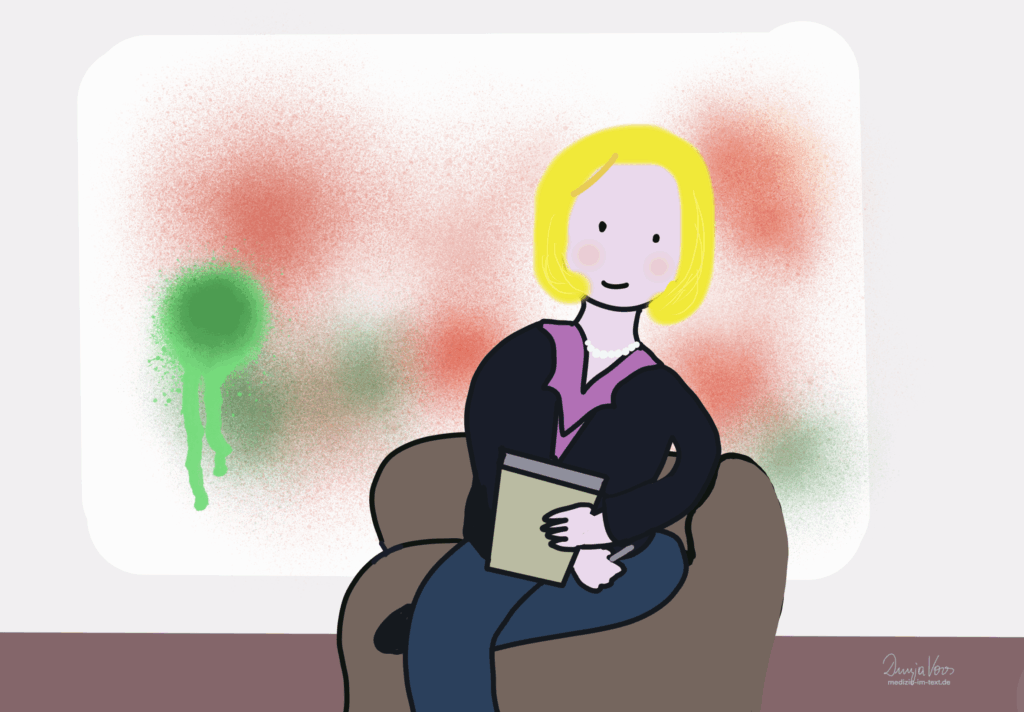
Ich muss mich nur so lange abgrenzen, solange ich überfordert bin. Der Chirurg muss sich nicht mehr von Blut abgrenzen, weil er es kennt. Wir Erwachsene müssen nicht mehr vor „Hänsel und Gretel“ weglaufen, weil wir verstanden haben, dass die böse Hexe ein Teil der guten Mutter ist. Wir können die Geschichte symbolisch verstehen. Wir können „Ja“ sagen, obwohl der andere auch „Ja“ sagt, wenn wir in uns spüren: Das sind wir selbst, die wir da „Ja“ sagen. Mich abgrenzen – oder besser gesagt „abwehren“ – muss ich als Psychotherapeutin nur so lange, bis ich mich selbst besser verstanden habe.
„Abgrenzen“ muss ich mich als Therapeutin natürlich vor den „Verführungen“ – von meinen inneren Verführungen und denen des Patienten. Ich möchte mich nicht verleiten lasse, etwas zu sagen, hinter dem ich nicht stehe. Ich kann einem möglichen Verliebtsein in einen Supervisor oder Patienten nicht auf Realebene nachkommen. Aber das hat nichts mit dem verkopften „Abgrenzen“ zu tun, wir wir es aus den unzähligen „Nein-Sage-Ratgebern“ kennen. Wenn wir uns ernsthaft abgrenzen möchten, dann spüren wir das vielleicht wie eine Welle oder Wallung in uns, die uns sagt: „Da möchte ich nicht hin“, oder „hier kommt der Patient mir zu nah“.
Daher ist es die beste Ausbildung für Psychotherapeuten, so viel Selbsterfahrung wie möglich zu machen. So kommen wir an unsere eigenen Perversionen, Borderline- und pychotischen Gebiete heran. Nur, wenn wir uns mit uns selbst wahrheitssuchend auseinandersetzen, können wir mit Interesse dem Patienten begegnen. Jemand kann nicht um seine Mutter trauern? Ein Patient möchte sich das Leben nehmen? Ein Patient emfindet Erregung bei dem Wort „Vergewaltigung“?
Fast alles, von dem Patienten erzählen, kann ich als Therapeutin vielleicht in irgendeiner Form in mir wiederfinden. Und ich kann dem nachgehen, es erfoschen, es symbolisieren. Wenn ich dem Leiden nicht aus dem Weg gehen will, sondern die Wahrheit als das Befreiendste empfinde, dann muss ich mich als Psychotherapeutin nicht im modernen Sinne „abgrenzen“. Ich trete in Resonanz mit dem Patienten, nehme ihn in Gedanken mit nach Hause, habe sogar vielleicht Gegenübertragungsträume. So wird die Arbeit manchmal verfolgend, bei Verstehen aber auch wirklich befriedigend. Und vor allem wird die Arbeit auf eine gewisse Weise viel weniger anstrengend, weil ich meine Kräfte nicht zum Abgrenzen einsetzen muss, sondern zum Verstehen.
Auch Patienten glauben häufig, dass der Therapeut „seine Gefühle abschalten“ müsse, damit er wirklich helfen kann. Doch ist das so? „Ein Patient möchte seine Tochter nach mir benennen! Ich finde, das geht zu weit, das kann er nicht machen!“, sagt eine junge Psychotherapeutin in einer Fortbildungsveranstaltung. „Warum denn nicht?“, fragt der Dozent. Darauf konnte sie kaum antworten. Es war einfach ein Gefühl, das sie quälte. Sie fühlte sich in ihren Grenzen nicht respektiert, sie fühlte sich bestohlen und nachgeahmt. Sie fühlte sich, als würde jemand in sie einsteigen, als würde ihr etwas weggenommen, als würde mit ihr etwas geschehen, was sie selbst nicht in der Hand hatte.
Doch all das lässt sich untersuchen – es gibt wertvolle Hinweise darauf, wie unsere Psyche funktioniert, was sich in der Psyche des Patienten bewegt, wie sich unsere Beziehung gestaltet. Wir müssen dem Patienten nicht verbieten, sein Kind nach uns zu benennen. Aber vielleicht können wir unsere unangenehmen Gefühle in die Therapie einbringen und zum wirksamen Agens werden lassen.
Oft wird deutlich, wie auch für Psychotherapeuten Symbolisches und Gedankliches zum Problem werden kann. Obwohl es sich nicht um sichtbare Dinge handelt (von einem Kind mit dem selben Namen einmal abgesehen), sondern nur um Ideen, Symbole, Wünsche und Gedanken, fühlt es sich an wie eine Gefahr oder eine Verletzung der Integrität.
Gerade ältere Psychoanalytikerr zeigen sich oft nicht mit Bildern im Internet. „Wer weiß, was Patienten damit machen?“, fragen sie ängstlich.
„Borderline-Patienten manipulieren einen. Da muss man echt aufpassen, sonst packen sie Dich und machen mit Dir, was sie wollen. Da weißt Du am Ende nicht mehr, wo oben und unten ist. Deshalb muss man sich vor ihnen schützen“, sagt ein Psychotherapeut. „Irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich wirke auf Therapeuten wie ein Monster. Dabei habe ich einfach nur Angst“, sagt ein Patient. Was also ist es, wovor der Therapeut „sich schützen“ will?
Das Gefühl, sich schützen zu wollen, hat mit dem eigenen Unbewussten zu tun. Je weniger ich es kenne, desto schwieriger kann die Beziehung zum Patienten werden. Eine Psychotherapie-Ausbildung sieht im Vergleich zur Psychoanalyse-Ausbildung nur wenige Selbsterfahrungsstunden vor. Patienten mit schwerem psychischen Leiden sind aber oft sehr feinfühlig und können das Unbewusste des Therapeuten häufig gut erfassen. Das ist es unter anderem, was Psychotherapeuten Angst machen kann und in ihnen das Gefühl weckt, sie müssten sich schützen. Sehr deutlich werden die Probleme, wenn Psychiater (mit sehr wenig psychoanalytischer Ausbildung) auf psychotische Patienten treffen. Da kommen Angst und Nicht-Verstehen so sehr zum Tragen, dass der Patient kurzerhand mit Medikamenten ruhig gestellt wird.
Sowohl beim Patienten als auch beim Psychoanalytiker findet eine Art Ich-Spaltung statt: Es gibt einen Teil im Inneren, der real erlebt wird und einen Teil, der weiß, dass es ja „nur Psychoanalyse“ ist. Also ich kann „wirklich“ sauer auf den Analytiker/auf den Patienten sein und es doch als eine „*Übertragung“, eine Art Spiel oder künstlich hergestellte Situation begreifen. So, wie wir im Inneren uns selbst beobachten können, so können wir auch sagen: Gerade könnte ich den anderen zum Mond schiessen, aber im Grunde weiß ich, dass ich ihm vertrauen kann. Manchmal geht der innere Abstand verloren und Psychoanalytiker und/oder Patient fühlen sich „ganz gefangen“ in der Szene. Wir können vielleicht noch wahrnehmen, aber nicht mehr denken. Wir können im Moment vielleicht noch beobachten, aber erst im Nachhinein kann der Abstand wiederhergestellt werden. Durch Verstehen werden unreife Beta-Elemente zu reifen Alpha-Elementen. Aber nicht immer. Manchmal bleiben die Dinge schwer fassbar und unaussprechlich.
Je besser wir uns selbst als Therapeuten kennen, umso geringer wird die Angst vor dem Patienten. Vereinfacht gesagt: Wenn ich eine schiefe Nase habe und mich mit Mitgefühl damit auseinandergesetzt habe, dann kränkt es mich nicht mehr so sehr, wenn jemand feststellt: „Du hast aber eine schiefe Nase!“ Will ich meinen Makel jedoch immer wieder schmerzvoll verdrängen, kann eine Bemerkung sehr verletzend wirken. Je besser ich als Psychotherapeutin durch eigenes Leid begleitet wurde, desto besser kann ich auch das Leid des Patienten verstehen oder zumindest begleiten.
Je tiefer ich verstehe, dass Psychotherapie und Psychoanalyse ein Feld der Unsicherheit und der Angst sind, desto gelassener kann ich damit umgehen. Natürlich nicht immer – es gibt immer wieder Phasen, die auch den erfahrensten Therapeuten zutiefst verunsichern, ängstigen und erschüttern.
Angst geht durch Verstehen häufig zurück. Wer die Säuglings-/Kleinkind- und Bindungsforschung kennt, der weiß, was Kinder mit der Mutter/dem Vater „machen“, um psychisch zu reifen. Nichts anderes „machen“ Patienten mit dem Therapeuten bzw. Psychoanalytiker auch. Es ist gut zu wissen, dass es zum Reifungsprozess des Patienten gehört, dass der Patient den Psychotherapeuten „benutzt“. Der Analytiker stellt sich sogar bewusst zur Verfügung, um sich psychisch vom Patienten benutzen zu lassen. Der Patient baut den Therapeuten sozusagen in seine Psyche ein.
Es gibt „das Böse“ und „böse Patienten“, die aus Gewalterfahrungen, Mangelerfahrungen und unglücklichen Entwicklungen heraus dem Psychotherapeuten/Psychoanalytiker wirklich schaden können. Allein das Wissen, dass Patienten ebenso wenig „liebe Engel“ sind wie andere Menschen und dass traumatisierte Menschen die erlebte Gewalt oft in sich tragen und reinszenieren, ist ein wichtiger natürlicher Schutz. Vorsicht, Bedacht, ein gutes Selbstgefühl, Austausch mit anderen und ein konsequenter Rahmen können ebenfalls als Schutz wirken. Wie weit sich ein Therapeut einlassen kann oder mit Schutz und Abgrenzung beschäftigt ist, hängt von unzähligen Faktoren ab.
„Man selbst ist als Person ja nicht gemeint“, sagen manche Psychoanalytiker. „Es findet eben alles in der Übertragung statt.“ Die Person des Analytikers ist nach diesem Modell sozusagen ein „Stellvertreter-Bild“ für andere Personen, mit denen der Patient frühere Beziehungen erlebte. Diese Sichtweise kann allerdings manchmal auch ein Schutz-Argument sein. Manche Analytiker sagen, dass Hass und Liebe nicht ihrer Person selbst gelten, sondern nur als Übertragungsliebe und Übertragungshass zu verstehen sind. Die Patienten jedoch erleben das meistens ganz anders: viel echter. Und auch viele Analytiker verstehen es in Zeiten der Intersubjektiven Psychoanalyse mehr als Mischung aus Übertragung und Real-Beziehung. Zwar bestehen auch Alltags-Beziehungen aus einer Mischung aus Übertragung und „echter“ Beziehung, doch in der Analyse ist der Übertragungsanteil oft sehr groß.
In Psychotherapie und Analyse spielen nicht nur die Gefühle des Patienten, sondern auch die des Therapeuten eine wichtige Rolle. Die Gefühle des Psychotherapeuten („Gegenübertragungsgefühle“) können dazu dienen, die Entwicklung des Patienten, aber natürlich auch die eigene Entwicklung zu fördern. „Wer ist dein grösster Meister?“, wird die Zen-Meisterin Gu Ja im Youtube-Video „Just eat, sleep and shit“ gefragt. Sie antwortet treffend: „You! You!“.
Mit zunehmender Erfahrung kann das Bedürfnis, sich als Psychotherapeut abgrenzen und schützen zu müssen, zurückgehen. Auch wir Therapeuten reifen mit unseren Lebenserfahrungen – wir werden Eltern oder erfahren den Schmerz der ungewollten Kinderlosigkeit und Partnerlosigkeit. Wir kennen die Arbeitswelt, Geldnöte, Krankheiten. Wir sind selbst erschüttert und können es zulassen, uns emotional berühren und auch erschüttern zu lassen. Ähnlich wie Kinder erst ab einem gewissen Alter aus Rührung weinen können, so können wir uns als Therapeuten auch erst mit der Zeit angstfreier von unseren Patienten berühren lassen. Eine Studie von Blume-Marcovici AC et al., 2013 hat gezeigt, dass erfahrene Therapeuten öfter mit ihren Patienten weinen als unerfahrene. Eine eigene Lehranalyse, die Schutz und Wärme bietet, macht den Analytiker freier. Dafür sind die Patienten meistens sehr dankbar.
„Von dem ganzen Abgrenzen werdet ihr nur müde.“ Ein Professor für Allgemeinmedizin zu seinen Studenten.
Der Psychoanalytiker lernt, dass er selbst das Instrument ist, das er dem Patienten zur Verfügung stellt. Welche Saiten in mir bringt der Patient zum Schwingen? Welche Reaktionen und Gegenübertragungsgefühle ruft er in mir wach? Der Psychoanalytiker arbeitet intensiv mit seinen Phantasien, Gefühlen und Erfahrungen und das macht er sozusagen zweigleisig. Er führt – wie der Patient auch – eine „Ich-Spaltung“ durch. Es gibt also einen Teil in ihm, der lässt den Patienten ganz nah an sich heran – er ist emotional offen, leidet mit, fühlt mit, schwingt mit, spielt mit. Ein anderer Teil in ihm aber ist der Beobachter, der nachdenken kann und der bemüht ist, den Überblick zu behalten.
Nicht zuletzt geben auch die vielen Theorien von Sigmund Freud und seinen Nachfolgern sowie die Kollegen im Geiste und die eigenen Freunde den Halt, den man in den Wogen braucht. Psychoanalytische Theorien, der äußere Rahmen und innere Hypothesen können innerlich ein Geländer sein. Dieses Wissen kann die Abgrenzung unterstützen.
Wie sehr die Neigung besteht, „sich abzugrenzen“ hängt von vielen Faktoren ab: vom Übertragungs-Gegenübertragungsgeschehen, von der Art der Traumatisierung des Patienten, aber auch von der eigenen Ausbildung, der Lebenssituation, von der eigenen Gesundheit und Stimmung sowie vom Eingebundensein in das berufliche und private Leben. Das Bedürfnis, sich abzugrenzen, ist an manchen Tagen größer als an anderen.
Wenn du das Geschehen zwischen dir und deinem Patienten emotional verstehen kannst, hast du oft gar kein Bedürfnis danach, dich „abzugrenzen“, das heißt, die Frage nach der Abgrenzung taucht gar nicht erst auf, weil die Abgrenzung natürlicherweise geschieht. Es ist ähnlich wie bei einem Mutter-Kind-Paar, wo die Mutter sich ja auch nicht „abgrenzen“ muss.
Sobald du merkst, dass du verkrampfst und dich um Abgrenzung bemühst, ist etwas „zu viel“, also unverstanden und unverarbeitet. Wenn sich mit der Zeit mehr verstehen lässt, kannst du innerlich wieder besser arbeiten – und das ist dann wie ein natürliches Abgrenzen, ohne darüber nachdenken zu müssen.
Es ist dann wie ein gemeinsames Spiel mit Instrumenten: Während eines Duetts fragst du dich nicht, wie du dich am besten abgrenzen könntest, sondern das Interesse gilt einzig und allein dem Zusammenspiel. Wie gelingt das Spiel, wie klingt der andere, wie klinge ich, wo führe ich, wo muss ich mich anpassen? Gerade die Psychoanalyse erinnert mich oft an gemeinsames Musizieren: Es ist ein Gleichgewicht zwischen Abgrenzung und Verbundenheit.
Sind Psychotherapeuten in der Therapie ergriffen, können auch ihnen die Tränen kommen. Die Psychologin Amy Blume-Marcovici und Kollegen (USA) haben 2013 eine Studie durchgeführt, in der sie 648 Therapeuten befragen. 72% gaben an, als Therapeut/Therapeutin schon einmal geweint zu haben, wobei die erfahreneren Therapeuten häufiger weinten als solche mit weniger Berufspraxis. Interessant dabei: Männliche und weibliche Psychotherapeuten gaben etwa gleich häufig an, in der Therapie zu weinen.
Sich berühren zu lassen ist eine Kunst, die sich immer wieder neu verfeinern lässt.
Seelische Qualen sind immer individuell. Und doch wissen wir wohl alle, wie sich Einsamkeit, Ausgeschlossensein, Verzweiflung und Scham anfühlen. „Aber mein Mitgefühl reicht ja nicht, um dem Patienten zu helfen“, sagt eine Ärztin. Und eben das ist die Frage: Wann reicht das Mitgefühl, wann ist geteiltes Leid halbes Leid und wann doppeltes? Geteiltes Leid ist dann halbes Leid, wenn wir mit unserem Leid auf ein wirklich offenes Ohr stoßen bei jemandem, der selbst ähnlich leidgeprüft ist wie wir es sind.
Wir fühlen uns angenommen, wenn wir spüren, dass der andere tatsächlich aufnehmen kann, was wir sagen. Es hilft uns, zu spüren, dass der andere mitfühlen kann und vielleicht selbst etwas ähnliches erlebt hat wie wir. Wenn wir sehen, dass er sich durch sein Leiden weiterentwickeln konnte, gibt uns das Hoffnung.
Geteiltes Leid ist dann doppeltes Leid, wenn wir auf jemanden treffen, der an einem sehr ähnlichen Leid leidet, der es aber selbst nicht ausreichend verdauen konnte. „Tja, da musste durch!“, hören wir dann. „Warum soll es dir besser ergehen als mir?“, wird uns entgegnet. Wir erzählen unser Leid vielleicht einem Psychotherapeuten, bei dem wir das Gefühl haben, mit unserem Gesagten auf eine Wand von Unverständnis zu treffen. Wir finden keine Resonanz – das Leid hallt auf uns selbst zurück. Und erscheint nun doppelt so schwer.
Wenn der Analytiker auf einen Patienten trifft, dessen Leid seinem eigenen ähnlich ist, gibt es ebenfalls verschiedene Wege. Konnte der Analytiker sein eigenes Leid in der eigenen Analyse bearbeiten, dann kann er das, was der Patient ihm mitteilt, gut aufnehmen. Er kann es verdauen, er kann es in sich Resonanz finden lassen und er fühlt sich sogar auf eine Art manchmal „erfrischt“ nach der emotionalen Begegnung mit dem Patienten. Beide fühlen sich besser.
Leidet der Analytiker jedoch ähnlich und hatte er noch nicht die Möglichkeit, das Leid selbst ausreichend zu bewältigen, dann spürt er die ungeheure Last des Patienten auch in sich. „Es ist mir zu viel“, mag er denken und fühlen. Möglicherweise kann er den Patienten nicht (weiter) behandeln.
Tritt während der Analyse mit einem Patienten ein Thema auf, das einen selbst als Analytiker aktuell beschäftigt und belastet, dann ist es gut, wenn man noch in der Ausbildung ist. Denn die DPV-Ausbildung sieht in der Regel vor, dass die Lehranalyse den gesamten Ausbildungsprozess begleitet. So können sich Patient und Ausbildungskandidat gemeinsam weiterentwickeln. Viele Analytiker begeben sich auch nach Abschluss der Ausbildung noch einmal in die Psychoanalyse.
„Wenn ich aber immer mitfühle, dann laugt mich das doch aus!“ – so ähnlich sagen es manche Studierenden und auch der Psychoanalytiker Jeffrey Masson („Final Analysis“) formulierte es so. Doch das Gegenteil ist der Fall: Wenn man dem Patienten einen Schritt voraus ist, dann muss man keine Kraft in die – oft gekünstelte – Abgrenzung stecken , sondern kann sich mit dem Patienten verbinden, was auf beiden Seiten zu einem befriedigenden Gefühl führen kann.
Einen Schritt voraus zu sein heißt nicht unbedingt, dass man bei diesem Problem innerlich auf einer höheren Stufe steht, dass man distanzierter ist oder selbst weniger leidet als der Patient, aber doch, dass man sich mit dieser Form von Leid schon ausführlich beschäftigt hat und mit dem eigenen Leid bekannter geworden ist. Man kann dann in der Tat „mitleiden“.
Es geht dem Patienten wahrscheinlich nie „genau so“ wie einem selbst. Doch die Ähnlichkeit verbindet. Es gibt eine Resonanz, die erholsam ist und die beim Patienten – und oft auch beim Analytiker – zur Linderung führt.
Der Psychoanalytiker Jeffrey Masson schreibt in seinem kritischen Buch „Final Analysis“, dass er in der Ausbildung gelernt hätte, was man sagen müsse, damit es dem Patienten besser geht. Natürlich kann man manche Sätze mechanisch daher sagen wie: „Das muss sehr schwer für Sie sein“ oder „Müssen Sie wirklich immer so viel tun? Reicht es nicht, einfach zu sein?“ Sätze wie diese entlasten den Patienten. Aber: Sind sie nur dahergesagt, dann sind sie sowohl für den Patienten als auch für den Analytiker eine Quelle der Unzufriedenheit.
Deswegen sagen viele Analytiker auch (z.B. Bion oder die Analytikerinnen in dem Film „Encounters through Generations“, Youtube): „Deute erst, wenn Du es selbst gefühlt hast.“ Das macht den entscheidenden Unterschied zwischen den Sätzen, die man vielleicht sagt, weil sie gut klingen und weil man meint, sie tun dem Patienten gut, und den Sätzen, die aus dem eigenen Berührtsein kommen.
Oft sind wir dem Patienten jedoch keinen einzigen Schritt voraus. Wir hören ihn sprechen und denken: „Genauso geht es mir selbst und ich sehe noch keinen Ausweg.“
„In all the problem areas of life in which the therapist has experienced difficulty, the patient is likely to have had even more, so that the therapist will find himself having to confront those areas of life in which he is still uncomfortable; however, the therapist will find that the patient’s difficulty is many times greater than that of the therapist.“ (S. 152 Bertram P. Karon: Psychotherapy of Schizophrenia, Aronson Inc. 1991/Rowman&Littlefield Publishers, 2004) Übersetzt von Voos: „In allen problematischen Lebensbereichen, die auch für den Therapeuten schwer zu meistern waren, hatte der (schizophrene) Patient wahrscheinlich noch mehr Probleme. Der Therapeut wird sich also mit Lebensproblemen konfrontiert sehen, die auch für ihn immer noch schwer zu bewältigen sind; jedoch wird er feststellen, dass die Schwierigkeiten des Patienten häufig weitaus größer sind.“ (Bertram Karon) Nicht selten aber spürt der Therapeut in bestimmten Bereichen auch, dass es ihm noch schlechter ging oder geht als dem Patienten.
Amy Blume-Marcovici et al. (2013):
Do therapists cry in therapy?
The role of experience and other factors in therapists‘ tears.
Psychotherapy, Vol 50(2), Jun 2013, 224-234.
dx.doi.org/10.1037/a0031384
Dieser Beitrag erschien erstmals am 30.8.2016
Akktualisiert am 5.12.2025
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Vielen Dank, so wahr, so wichtig in Psycho-Berufen! Lg
Liebe Fischmondfahrt ;-),
also ein Kind „benutzt“ ja seine Eltern, es „verwendet“ sie ja. Es testet an ihnen Phantasie und Wirklichkeit, Mädchen-Sein, Junge-Sein, „Mülleimer-Funktionen“, Wiedergutmachungsversuche, Wütend-Machungs-Versuche, Verführung, Verheimlichungen, Gedankensicherheit, Reizbarkeit, Abschiedsverhalten, Gefühle bei Abwesenheit etc. Daran lernt das Kind sich selbst und seine Gefühle sowie die Reaktionen des anderen kennen. Es lernt dabei auch, zu mentalisieren. Und es fragt sich immer: Überlebt Mutter/Vater meine Angriffe? Meinen Neid? Meine Eifersucht, meine Liebe, meine Tötungswünsche, meine Beziehungs- und Trennungswünsche etc.? Kann der andere ein getrennter Mensch bleiben oder wird er übergriffig? Alles Fragen, die ein Kind bei Mutter/Vater ausprobiert. Der Analytiker ist jemand, der sich für diese „Forschungen“ benutzen lassen kann: Er wird zum Liebesobjekt, zum Hassobjekt, zum Verfolger etc. Der Patient kann den Analytiker als „Mülleimer“ benutzen, als „Sorgenfresser“, als Feind, Freund oder phantasiertes Liebesobjekt. Meistens kommt der Patient ja, weil die eigenen Eltern hier irgendwo nicht so reagierten, wie es für das Kind gesund gewesen wäre. Wenn der Betroffene dann als Patient wiederholt etwas ausprobieren kann, was früher schief ging, dann kann er Altes wiederherstellen, es untersuchen und schließlich auch Unterschiede feststellen und häufiger erleichternde gute Ausgänge erleben. Manche Patienten werden einfach dadurch stückweise gesund, dass sie merken: Der Analytiker überlebt meine Angriffe, meinen Hunger etc. Das erfährt der Patient aber nur, wenn der Analytiker bereit ist, sich „benutzen“ zu lassen, also sich z.B. nicht wehrt, wenn der Patient ihm eine bestimmte Rolle überstülpt, z.B. eine sadistische Rolle, um etwas bewusst werden zu lassen.
Also um in Ihren Worten zu bleiben: Der Patient muss ja die alten Beziehungsstrickmuster erstmal wiederherstellen, um zu erkennen, was da überhaupt passiert. Wenn das dann analysiert und erfasst wurde, dann kann er ein Gefühl dafür bekommen und Dinge auch bewusst verändern.
Herzliche Grüße, Dunja Voos
Liebe Dunja Voss,
sehr interessant der Artikel! Mir ist nur nicht klar, inwiefern ein Patient einen Therapeuten „benutzen“ soll. Ist nicht Sinn der Sache, dass statt funktionalisierender „Beziehung“ eine wirkliche Bezogenheit erlernt, gefördert werden soll? Wieso macht es Sinn, in alten Beziehungsstrickmustern hängen zu bleiben indem sie weiter praktiziert werden? Vielleicht fehlt mir einfach nur ein Beispiel um zu verstehen was gemeint ist.
Herzlicher Gruss, Fischmondfahrt