



Wenn Du richtig wütend bist – wie fühlt sich das an? Wie ein Erdbeben? Wie eine Wallung, die von unten hoch kommt? Zittern deine Hände? Wirst Du rot und möchtest ganz laut schreien? Wut ist ein sehr, sehr starkes Gefühl. Wenn man wütend ist, bekommt man ungeheure Kraft. Und es wird einem alles egal – man will die Wut nur los werden. Wir glauben manchmal, dass wir explodieren, wenn wir jetzt nicht jemanden anschreien. Kleine Kinder schlagen einfach zu, wenn sie wütend sind. Das ist wie ein Reflex: Zack, ist die Schaufel auf dem Kopf des anderen.Weiterlesen
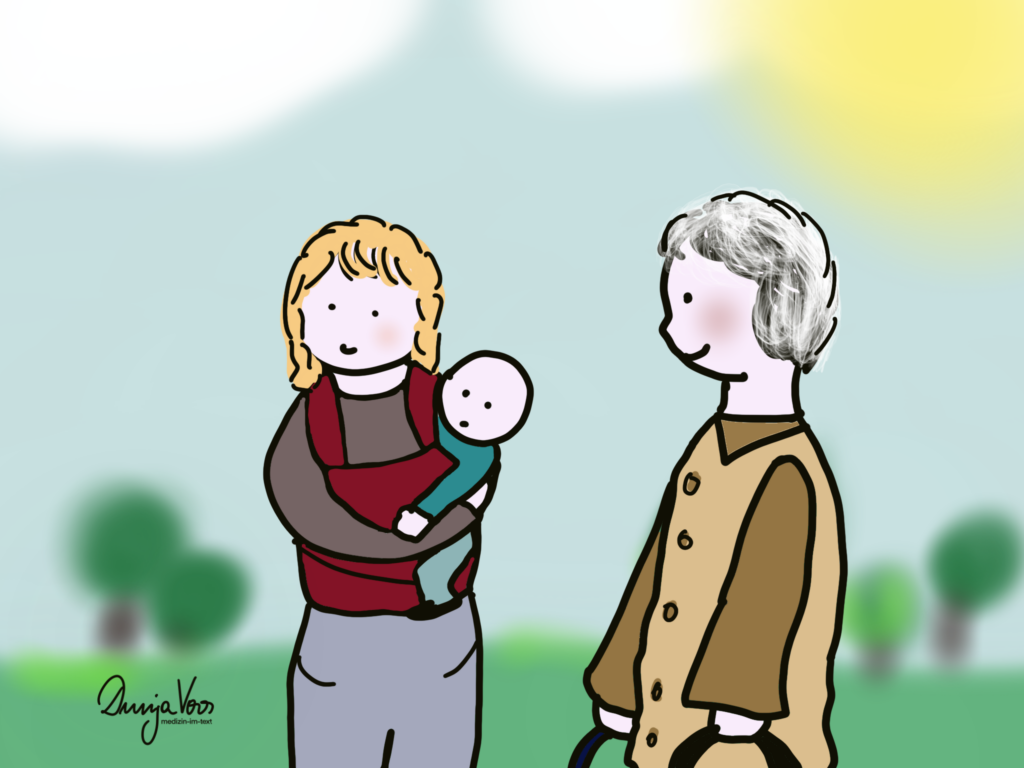
wenn wir mit kleinen kindern kommunizieren, dann kommen wir ihnen manchmal zu nah. sie brauchen eine pause von der engen kommunikation mit uns. sie sitzen auf unserem arm oder stehen bei uns, während wir sie angucken und mit ihnen sprechen. plötzlich zeigen sie mit dem finger in die außenwelt und sagen: „Da!“ manchmal bedeutet das, dass sie etwas Gesehenes mit uns teilen wollen. Oft aber ist dies auch eine form der bitte, wir mögen unseren blick für einen moment von ihnen nehmen. wir könnten darin auch im negativen sinne einen versuch der „manipulation“ sehen, doch anders formuliert ist es mitunter auch das: die kinder haben freude daran, wenn wir so funktionieren, wie sie es erwarten. sie fühlen sich selbstwirksam und es gibt ihnen sicherheit, wenn wir ihnen in dem moment folgen. Weiterlesen
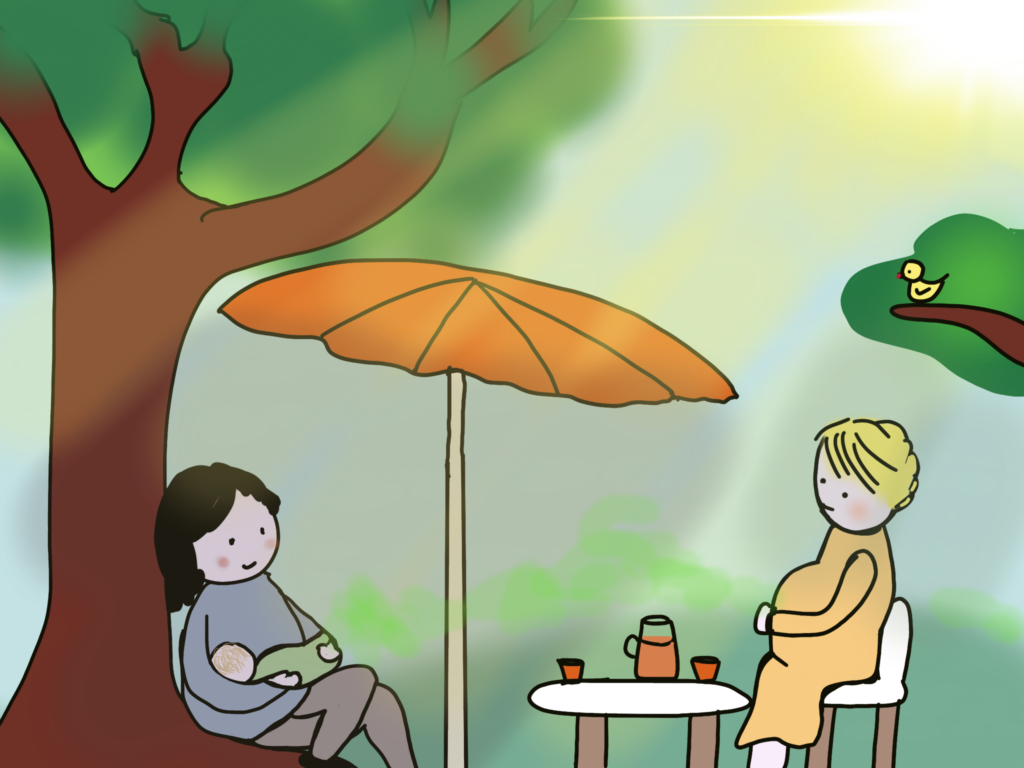
Der Schweizer Kinderarzt Remo Largo hat in seiner Zürcher Längsschnittstudie gezeigt, dass Kinder früherer Zeiten nicht früher sauber wurden als die Kinder heute, sondern dass die Eltern sie nur viel öfter über das Töpfchen hielten. Beim Kinderarzt hören wir oft, dass die bewusste Kontrolle der Schließmuskeln (Sphincter vesicae der Blase und Sphincter recti des Darmausgangs) erst mit zwei oder drei Jahren möglich sei. Fragend oder gar verächtlich schauen wir manchmal auf die osteuropäischen Länder, wo die Kinder angeblich schon mit einem Jahr trocken sind. Wir können uns das nicht vorstellen. Meistens gehen wir davon aus, dass diese Kinder besonders streng erzogen werden und dadurch Schaden erleiden, denn nach der klassischen psychoanalytischen Theorie gibt es möglicherweise einen Zusammenhang zwischen einer strengen Sauberkeitserziehung und einer späteren Zwanghaftigkeit beim Kind.Weiterlesen
Als Mutter hört man ein Argument besonders oft: „Das überträgt sich auf’s Kind!“ Das sagen nicht nur Nachbarn und Feinde Freunde, sondern auch Kinderärzte, Lehrer oder Therapeuten. Wann immer eine Mutter diesen Satz hört, fühlt sie sich auf merkwürdige Weise dazu aufgefordert, sich besser zu kontrollieren und das Negative von sich wegzuschieben. Sie bemüht sich, nichts Schlechtes über die Kita oder den Partner zu sagen und gibt sich mutiger als sie ist. Doch in Wirklichkeit verändert sie damit nichts. Denn was das Kind mitbekommt, ist das Unbewusste. Weiterlesen