



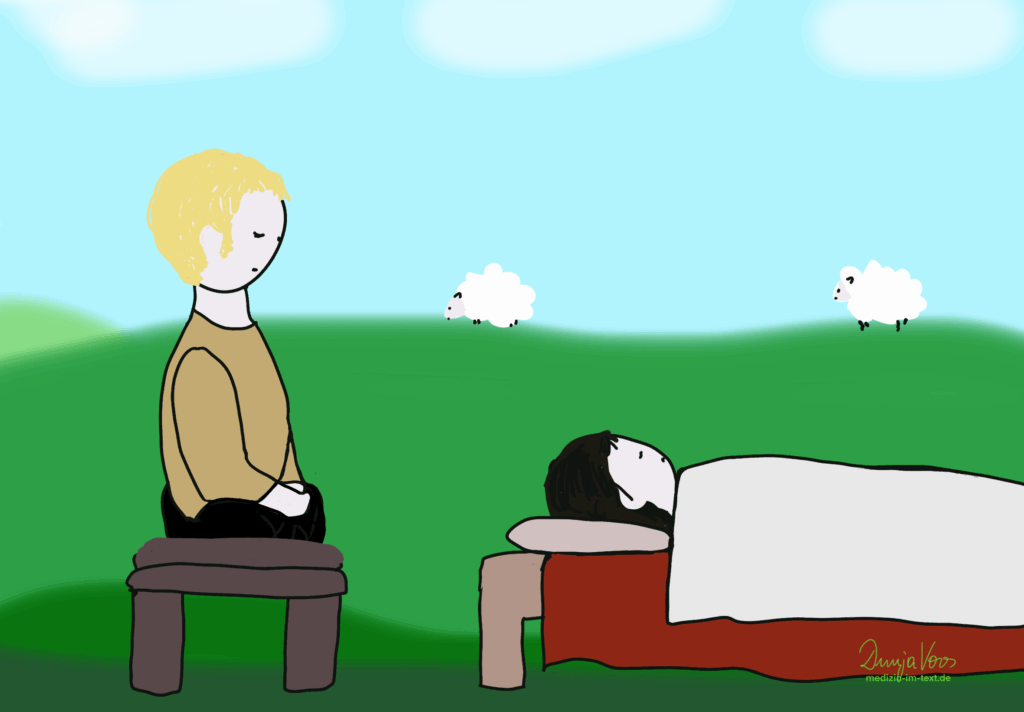
Mit schwer traumatisierten Patienten solle man in der Psychotherapie nicht lange schweigen, weil dann der Phantasieraum angeregt würde und die Patienten in der Haltlosigkeit abstürtzen, heisst es oft. Doch es kommt auf die Art des Schweigens an: Wenn ich mich als Psychoanalytikerin emotional „einklinke“ und wirklich präsent bin, dann suchen auch schwer traumatisierte Menschen immer wieder das lange Schweigen. So werden sie der Schwierigkeit, überhaupt Worte zu finden, gerecht.
In dem Buch „Pioneers of Interpersonal Psychoanalysis“ schreibt die Psychoanalytikerin Lisa Fromm-Reichmann (1939): „Der Patient wird nicht gebeten, sich hinzulegen oder frei zu assoziieren; beide Anweisungen ergeben für ihn keinen Sinn. Er sollte sich frei fühlen zu sitzen, auf dem Boden zu liegen, herumzugehen, sich auf irgendeinen Stuhl zu setzen, auf der Couch zu sitzen oder liegen. Alles ist egal, nur Eines ist wichtig: dass der Analytiker dem Patienten erlaubt, sich wohl und sicher genug zu fühlen, um seine defensive narzisstische Isolation aufzugeben und um den Arzt dafür zu nutzen, wieder Kontakt mit der Welt aufzunehmen.“
Die Psychoanalytikerin Lisa Fromm-Reichmann (Psychoanalytikerinnen.de) (1889-1957) behandelte die damals psychotische Joanne Greenberg (Goodreads) (geb. 1932), Autorin des Buches „Ich habe dir niemals einen Rosengarten versprochen“. Greenberg beschreibt in dem Film „Take these broken wings“ eindrücklich, wie sich ihre Psychose anfühlte. Fromm-Reichmann habe ihr gesagt, sie müsse es ihr genau erzählen, wie sich ihre Psychose anfühle, denn sie selbst (Fromm-Reichmann) hätte so etwas nie erlebt.
Fromm-Reichmann schreibt weiter: „Wenn es dem Patienten entgegenkommt, eine Sitzung in gegenseitigem freundlichen Schweigen zu verbringen, dann ist er eingeladen, schweigsam zu bleiben. Ein Patient beschrieb sein Erleben dabei so: ‚Es ist die Freude, es zu wagen, zu atmen und zu vegetieren und einfach zu sein, in der Anwesenheit eines anderen Menschen, der nicht eingreift.‚ Die einzige Gefahr dieser friedlichen schweigsamen Stunden sei, so Fromm-Reichmann, dass der Patient mehr Spannung in seiner Beziehung zum Analytiker aufbaut, als der Patient aushält, so dass es zu großer Angst kommt.“
Fromm-Reichmann weiter: „Es gehört zu den ‚künstlerischen‘ Funktionen, wie Hill (1936) sie genannt hatte, zu fühlen, wann die Zeit gekommen ist, um das freundliche Schweigen des Patienten zu unterbrechen.“ (Transference problems in schizophrenics, In: Pioneers of Interpersonal Psychoanalysis, herausgegeben von Donnel B. Stern et al.: S. 37/38, 1995/2015, www.tandfebooks.com/…)
Manchen Patienten ertragen „die Intimität der Stille“ nicht, wie der Psychoanalytiker Harold Searles schreibt im Buch „Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung“ schreibt (S. 159). Doch die nonverbale Kommunikation ist einzigartig und ein wichtiger Baustein in der psychoanalytischen Therapie – besonders in der Therapie schwer kranker Patienten. Im Sitzen werden zahllose Blicke ausgetauscht. Man erkennt „Zärtlichkeit, Belustigung, Behaglichkeit, Verlegenheit und dergleichen mehr“ (Searles, S. 159).
Liegt der Patient in der Psychoanalyse auf der Couch und kann man sich nicht sehen, spielen Atemgeräusche, Darmgeräusche, Düfte und Gerüche, Bewegungen mit den Händen und Beinen, Schluckgeräusche, Gähnen usw. eine Rolle. Manchmal schweigen Patient und Therapeut immer wieder sehr lange.
Harold Searles (1918-2015) gelang „zu der festen Überzeugung, dass eine derartige nicht-verbale Kommunikation echt, gültig und verlässlich sein kann.“ Er „erkannte auch, dass sogar eine verbale Interpretation den Wert der nicht-verbalen Kommunikation nicht hätte beeinträchtigen können“ (S. 159). Es gelte, einer „rein nicht-verbalen Kommunikation mit einem Mitmenschen zu vertrauen und die ihr innewohnende tiefe Bedeutung zu erfahren“ (Searles, S. 160).
In dem Film „Take these broken wings“ (Youtube) sprechen Analytiker über ihre Arbeit mit schizophrenen Patienten. Ein Analytiker (Dr. Daniel Dorman) beschreibt, wie er über einen langen Zeitraum einfach nur 50 Minuten mit seiner Patientin da saß und schwieg. Searles: „Ich stimme mit Ruesch (1955), Wikipedia, völlig überein, wenn dieser erklärt, dass der Patient kommunikative Erfahrungen auf nicht-verbalem Gebiet machen muss, bevor er mit anderen verbal verkehren kann.“ (Harold Searles 1965, S. 159, Jurgen Ruesch 1955, S. 326)
„Bei den meisten chronisch schizophrenen Patienten, mit denen ich arbeitete, erlebte ich eine vorwiegend nicht-verbale Phase, die sich über einige (und in manchen Fällen über viele) Monate erstreckte. Es handelt sich hier zweifellos um die Phase, die der in Wien geborene Psychoanalytiker Kurt Robert Eissler, Wikipedia, (1908-1999) als die „Phase einer relativen klinischen Stummheit“ bezeichnete (Eissler, 1951).“ Das schreibt der Psychoanalytiker Harold Searles in seinem Buch „Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung“ (S. 148). Während des Schweigens können Patient und Analytiker das Gefühl haben, sie seien wie eine Mutter-Säuglings-Einheit.
Harold Searles hält es für wichtig, der nonverbalen Phase ausreichend Zeit zu geben. So, wie sich die Psyche des Säuglings zuerst in einer nonverbalen Phase mit der Mutter entwickelt, so brauche auch der schwer Kranke diese Zeit des Kennenlernens und Vertrautwerdens. „Der Übergang in die verbale Beziehung kann für beide ein schmerzlicher Schritt sein. Der Patient bekommt festere Ichgrenzen und er muss seine „ozeanische Ich-Welt-Beziehung aufgeben.“ (Searles)
Der Psychoanalytiker solle nichts sein als die Projektionsfläche des Patienten, hieß es früher in der Psychoanalyse. Immer wieder berichten Patienten davon, dass sie ihre Analyse abgebrochen oder schlechte Erfahrungen gemacht haben, weil der Analytiker zu viel schwieg. Ich frage mich dann meistens, was da passiert ist und wie genau das zu verstehen ist. Das Schweigen des Analytikers ist meistens ein „präsentes Schweigen“. Das heißt, der Psychoanalytiker ist „voll da“, doch der Patient erlebt mitunter pure Verlassenheit.
Manche fühlen sich durch das Schweigen entsetzlich gequält. Hier liegt es am Psychoanalytiker, diese Gefühle aufzunehmen und es dem Verstehen zuzuführen. Das lernt der Psychoanalytiker in seiner Ausbildung – vor allem in der eigenen Lehranalyse.
Wie sehr ein Analytiker schweigt, hängt von vielen Faktoren ab: von seiner Ausbildung, seiner Ausrichtung, seiner Persönlichkeit, seinen eigenen Erfahrungen, seinen Absichten und Vorstellungen, von der Stundenfrequenz und vom Zustand des Patienten. Der Psychoanalytiker dosiert das Schweigen so, dass es dem Patienten angemessen ist und dass daraus eine fruchtbare Spannung entsteht.
Und was braucht der Patient? Ist er heute sehr ängstlich und geht es ihm schlecht, spricht der Analytiker unter Umständen mehr. Es gibt jedoch auch viele Situationen, in denen es dem Patienten sehr schlecht geht und er gerade dann das Schweigen braucht. Ich selbst dachte manches Mal in meiner Psychoanalyse im Liegen auf der Couch: „Bitte, bitte, sag jetzt nichts.“ Und wenn der Analytiker tatsächlich lange schwieg, dachte ich: „Meine Güte, er hat Mut! Er kann das lange Schweigen aushalten!“
Im Schweigen bekommen die Phantasien und das Unbewusste Raum und alte Schmerzen tauchen wieder auf. Atmosphären entstehen. Oft kann man als Analysand spüren, wie der Analytiker im Schweigen sozusagen psychische Verdauungsarbeit leistet. Je erfahrener ein Analytiker ist, desto intuitiver und angemessener kann er das Schweigen nutzen und dosieren.
Die Patienten merken oft, dass ihnen dieses Schweigen gut tut. Tut es ihnen nicht gut, können einige es zur Sprache bringen, andere (noch) nicht. Hier sind die Patienten darauf angewiesen, dass der Analytiker sich interessiert zeigt und dazu anregt, Worte für das eigene Befinden zu finden. Das Schweigen kann Verlassenheitsängste, Wut und Verzweiflung hervorrufen, aber auch Gefühle der Geborgenheit und des Berührtseins. Es kann retraumatisieren, doch die Retraumatisierung sollte „wohldosiert“ sein.
Im Schweigen hat auch der Psychoanalytiker die Chance, etwas vom Patienten zu erfassen und eigene Phantasien zu entwickeln. Er lässt den Patienten sozusagen in seinem Beisein allein. Es entsteht ein Feld. Natürlich ist den Analytikern bewusst, dass die Psychoanalyse für die Menschen, die einen Analytiker erstmals aufsuchen, Neuland ist. Das heißt, viele Analytiker achten gerade am Anfang darauf, die Patienten mit ihrem Schweigen nicht zu „erschlagen“.
Viele Menschen, die eine Psychoanalyse beginnen, litten unter abwesenden oder nicht-reagierenden Eltern. Schweigt der Analytiker, können alte Gefühle neu geweckt werden. So eine Situation bietet die Grundlage, um die alten Traumata im Hier und Jetzt neu zu erfassen und zu bearbeiten.
Sich auf die Couch zu legen und den Analytiker nicht mehr zu sehen, ist für viele eine kaum vorstellbare Situation. Oft beginnt man dann bei diesen Patienten mit einer Therapie im Sitzen und arbeitet daran, Vertrauen aufzubauen. Diese Phase kann sehr lange dauern. Wenn man zunächst zu zweit im Raum sitzt, fällt der Blick des Patienten mit der Zeit öfter auf die Couch. Wenn Analytiker und Patient dann eine Weile zusammengearbeitet haben (Wochen, Monate oder auch manchmal Jahre), wagt sich der Patient auf die Couch.
Ich mache übrigens auch sehr gute Erfahrungen mit der Online-Psychoanalyse: Der Patient, der zu Hause auf seiner eigenen Couch liegt und die Kamera so einstellt, dass ich ihn nur etwas sehen kann, kann ebenfalls sehr intensive Zustände erleben. Es kann zu Now-Moments kommen, die denjenigen der „echten Psychoanalyse in einem Raum“ in nichts nachstehen.
Oft ist es so, dass die Patienten im Laufe der Therapie im Sitzen immer häufiger auf die Couch schauen. Mit dem Vertrauen wächst auch oft der Wunsch, sich fallen zu lassen und das nachzuholen, was man nie erlebt hat: sich einem anderen Menschen auszuliefern und dabei in Sicherheit zu sein. Irgendwann werden Wunsch und Neugier größer als die Angst.
Die analytischer Arbeit kann dem Patienten und dem Analytiker viel Freude bereiten, weil man spürt, wie man endlich Klarheit gewinnt, auch, wenn die Analyse natürlich oft mit Leid verbunden ist. Schweigen bedeutet Stille. Und Stille bedeutet oft Einsamkeit. Als Patient kann man sich auf der Couch sehr einsam fühlen – doch auch der Analytiker hinter der Couch ist oft einsam. Manchmal merkt man als Patient auf der Couch erst nach langer Zeit, dass der Analytiker im Schweigen das eigene Leid psychisch irgendwie „mit-verdaut“.
Der Analytiker ist ein nachträglicher Zeuge, der einem dabei hilft, Wege aus den engen inneren Räumen zu finden und neue, weitere Räume zu schaffen. Das Schweigen empfinden viele Patienten mit der Zeit als Wohltat, weil es da endlich jemanden gibt, der nicht gleich reagieren oder gleich etwas tot reden muss. Was man herausfindet, findet man in guter Begleitung selbst heraus. Somit bietet das Schweigen auch die Chance, die Dinge selbst herauszufinden, sich zu entwickeln und schließlich das Gefühl zu haben, vieles „alleine“ geschafft zu haben.
Eissler, Kurt Robert (1951):
Remarks on the Psycho-Analysis of Schizophrenia
Bemerkungen zur Psychoanalyse der Schizophrenie
International Journal of Psycho-Analysis (1951) 32: 139-156
Howard B. Levine (2021):
Affect, Representation and Language
Between the Silence and the Cry
Routledge, 2021
Ruesch, J (1955):
Nonverbal Language and Therapy.
Psychiatry 18, 232-330
DOI:10.1521/00332747.1955.11023017
www.tandfonline.com
Searles, Harold F. (1965/2008):
Der psychoanalytische Beitrag zur Schizophrenieforschung
Original: Collected Papers on Schizophrenia and Related Subjects (1965)
Buchreihe: Bibliothek der Psychoanalyse
275 Seiten, Broschiert, Format: 148 x 210 mm
Verlag: Psychosozial-Verlag
Erschienen im Juli 2008
Beitrag vom 18.2.2026 (begonnen am 28.6.2017)