



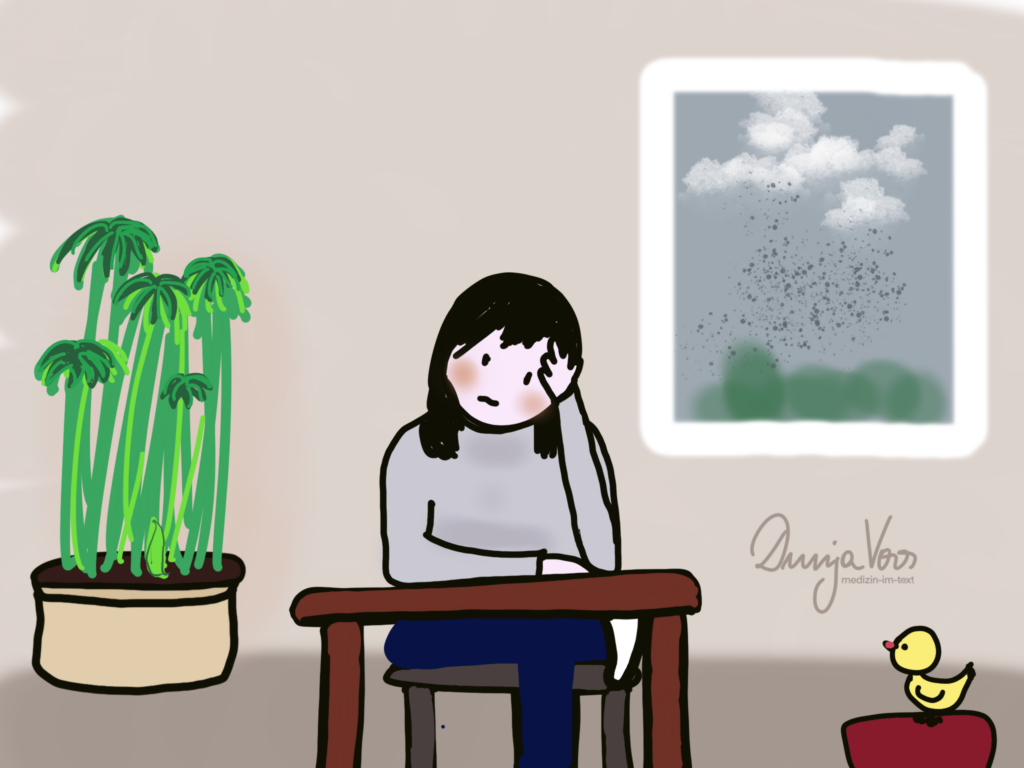
Es beginnt am Anfang des Lebens, wenn der Schwangeren gesagt wird: „Schmerzen unter der Geburt müssen heute nicht mehr sein.“ Die Frau erhält eine Periduralanästhesie (PDA). Doch das Leiden ist nicht unbedingt nur gleich „Schmerz“: „Ich habe unter der Blasenlähmung durch die PDA gelitten und hinterher hatte ich höllische Kopfschmerzen“, sagt die junge Mutter nach der Geburt. Wir wollen so gerne Leiden beseitigen – doch schaffen wir dadurch oft auch neues Leiden. Dass der Geburtsschmerz – ebenso wie manch anderer Lebensschmerz – seinen Sinn haben kann, wird von vielen nicht so gesehen. Doch manchmal spüren wir diesen Sinn mitunter selbst – oft erst im Nachhinein.
Wie oft sagen wir: „Ich will das los werden!“ Wir leiden ganz schrecklich unter unseren Symptomen. Wir versuchen, ihnen davonzulaufen oder sie mit Medikamenten zu betäuben – was verständlich ist, insbesondere, wenn wir mit unserem Leid alleine sind. Doch vieles lässt sich nicht so leicht los werden. Manches ist morgen nicht wieder gut – und wir müssen in so manches Leid langsam hineinwachsen.
Heute leiden wir häufig unter einer Art „Gut-geh-Stress“. Wir sagen uns: „Wenn ich leide, dann mache ich etwas falsch.“ Wir schämen uns vielleicht, wenn wir trotz der Möglichkeiten der modernen Medizin und Psychotherapie dennoch leiden. Zwanghaft Leid verhindern oder „wegbekommen“ zu wollen, führt oft zu noch mehr Leid. Doch wenn wir – sofern noch genügend Abstand besteht – eine Beziehung zu unserem Leiden aufnehmen können, kommt es paradoxerweise oft zu einer ersten Linderung. Darüber spricht der Yogalehrer Desikachar (1938-2016) in berührender Weise in seinem Video „On Healing with Yoga“ (Youtube).
Manchmal fühlen wir uns verzweifelt, weil wir das Gefühl haben, niemand versteht uns. Gleichzeitig glauben wir verständlicherweise, dass unser Leid das größte sei, denn schließlich können wir vor uns selbst nicht weglaufen und wir sind es, die damit leben müssen. Es gibt aushaltbares und unaushaltbares, tragbares und nicht mehr tragbares Leid. Wenn es „zu viel“ wird, wenn uns das Leid überschwemmt, dann meinen wir, sterben zu müssen – und an manchem Leid sterben wir schließlich auch. Schmerz, Angst, Erinnerungen, Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit können uns zu groß werden oder zu lange dauern. Das macht uns Angst.
Wenn wir nicht „natürlicherweise“ an unserem Leid sterben und niemanden haben, der es mit uns trägt, können Suizidgedanken oder gar Suizid die Folge sein. Manchmal aber hören wir jedoch den Satz: „Make it right till the end“, also sinngemäß: „Lebe bis zum Ende.“ Je nachdem, wie wir uns fühlen, kann im Leiden unser Forschergeist geweckt werden. Wir können denken: Was hat die Natur uns zu bieten? Was passiert „natürlicherweise“ mit dem Leid und unseren Reaktionen darauf? Welchen Einfluss haben Einsamkeit und Beziehungen auf unser Leiden? Und was passiert, wenn wir warten und beobachten?
Oft vergleichen wir uns in unserem Leiden mit anderen. Es scheint eine Art „Leid-Skala“ zu geben, sodass wir meinen, sagen zu können: „Mein Leid ist größer als Deins.“ Ein besonderes Problem bleibt dabei das Zuviel. Wenn es uns zu viel wird, dann laufen wir über: Wir übergeben uns, bekommen Durchfall, wir weinen, schreien, fliehen, verlieren das Bewusstsein oder sterben an Herzversagen. Besonders beim akuten Zuviel, bei der „Katastrophe“ spüren wir, wie die existenzielle Bedrohung unseren Körper beeinflusst. Der Umgang mit Leid erfordert viel Einfühlungsvermögen (in Bezug auf uns selbst und auf andere), Intelligenz und oft Wissen – manchmal, wenn wir keine Hoffnung mehr aufbringen können, dann kann uns mitunter unser pures Wissen helfen – zum Beispiel das Wissen, dass unser Leiden mit bereits Erlebtem zusammenhängen kann und dass die Zeit, auch wenn sie sehr lang werden kann, Veränderung bringt.
Der Psychoanalytiker Adam Phillips spricht in einem BBC-Vortrag über das „Zuviel“: „On being too much for ourselves“, 2014, https://youtu.be/EQ3PNd7nv54.
Nach dem akuten Leiden kommt manchmal das chronische Leid. Die Frage ist dann oft: Was hilft bei chronischem Zuviel oder auch bei schwer erträglicher Leere? Wie kann Leid so behandelt werden, dass es handhabbar wird? Wenn ich leide und es ist jemand da, der mich verstehen will, dann wird das Leid dadurch häufig erträglicher. Wenn jedoch der, der mich liebt, mein Partner, meine Eltern oder meine Kinder sind, dann kann das Leid auch schwerer wiegen, weil wir nicht wollen, dass der andere mitleidet. Bei Depressionen kann das Leid (erstmal) wieder kleiner werden, wenn wir den Liebenden verlassen. Leid hat immer mit Beziehung zu tun bzw. dem Fehlen von Beziehung. In der Einsamkeit leiden wir meistens besonders. Und auch diese Erfahrungen in Einsamkeit können wir erkunden und versuchen, sie in Worte oder Bilder zu fassen.
„Wenn ich leide und ich schreibe darüber, dann geht es mir besser.“ Für viele ist das Erzählen eine wirkungsvolle Therapie. Das Darüber-Sprechen, das einsame Stillwerden oder auch das gemeinsame Schweigen kann Leid lindern.
Der Philosoph Jiddu Krishnamurti (1895-1986) hat viel zum Thema Leiden gesagt (siehe Youtube). Er sagt, dass es nicht nur „mein Leid“ und „dein Leid“ gibt. Das Leid von Eltern, die ihr Kind verloren haben – mit was kann es verglichen werden? Ist das Leid des Kindes, das gerade seinen Teddy verloren hat für den Moment anders? Ist es kürzer? Krishnamurti spricht von „Das Leid“, das alle Menschen verbindet. Darum weinen wir auf Hochzeiten. Wir verstehen „das Leid“ und wenn wir jemanden anschauen, der leidet, fühlen wir uns an unser eigenes Leiden erinnert. Es berührt uns, wenn wir gelernt haben, auch auf unser eigenes Leiden zu blicken. Der Gedanke an das Verbindende, an das Leid an sich, kann unser eigenes, höchst individuelles Leid vielleicht ein bisschen lindern.
Dieser Beitrag wurde erstmals veröffentlicht am 25. August 2017
Aktualisiert am 12.10.2023
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Liebe/r Schnurpfel53,
vielen Dank für Ihren Kommentar!
Viele Patienten fragen sich in der Psychotherapie, ob sie nicht jemand anderem den Platz wegnehmen, ob sie genug leiden. Daran dachte ich bei dem, was Sie schrieben.
Liebe Frau Voos
Vielen Dank für den einfühlsamen Beitrag über das Leid.
Besonders die Überschrift „ich leide mehr als du“ und der Satz im letzten Absatz „Der Gedanke an das Verbindende, an „das Leid“, kann unser eigenes, höchst individuelles Leid vielleicht ein bisschen lindern“, gefallen mir sehr, da mich diese beiden Aspekte im Umgang mit dem Leid anderer und dem eigenen Leiden immer wieder beschäftigen.
„Ich leide mehr als du“ führt zu einer Bagatellisierung des Leids des anderen. Ebenso umgekehrt kann das Denken, dass es immer noch Schlimmeres auf dieser Erde gibt dazu führen seine ureigensten Ängste einfach zu negieren. Vielleicht eine Form vom „Psychoanästhesie“?
Umso erleichternder erlebe ich den Gedanken von Jiddu Krishnamurti, dass wir auch durch das Leid als Menschen bzw. lebendige Wesen verbunden sind und es nicht um einen Leidenswettbewerb geht.